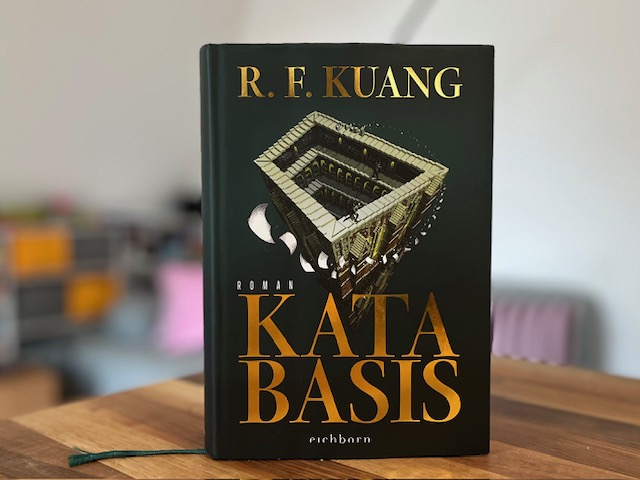Mit »Katabasis« legt die sino-amerikanische Autorin Rebecca F. Kuang in kürzester Zeit ihren dritten und einen weiteren ehrgeizigen, wenngleich langatmigen Roman vor. Nach »Babel« führt sie ihre Leser*innen erneut in akademische Gefilde. Statt nach Oxford geht es diesmal ins benachbarte Cambridge, wo sich das Tor zur Unterwelt nicht in den Tiefen der Mythologie, sondern im Labor eines Instituts für »Analytische Magie« öffnet.
Schon der Titel »Katabasis« – die Held*innenreise in die Hölle – zeigt die Richtung in dieses Romans an und ist Programm. Kuangs Protagonistin Alice Law, Doktorandin in einer Disziplin zwischen Linguistik und analytischer Magie, stürzt sich nach einem missglückten Experiment – bei dem ihr Doktorvater Jacob Grimes buchstäblich in den Tee »plumpst« – in eine infernalische Reise, um ihn aus der Hölle zurückzuholen. Begleitet wird sie von einem Kommilitonen, Peter Murdoch, dessen Nähe nicht nur dem gemeinsamen wissenschaftlichen Interesse entspringt.
Zwischen Dante und David Lodge
BookTok-Star Rebecca F. Kuang verwebt in ihrem neuen Roman viele literarische Texte und Traditionen, die zwar zahlreiche Lesestandpunkte anbieten, aber kein logisches Bild ergeben. Da ist zum einen der stetige Bezug auf einen literarischen Kanon der Höllenliteratur, von Dantes »Inferno« über den Mythos um »Orpheus und Eurydike« bis hin zu T.S. Eliots »The Waste Land«. Allesamt Texte, die die Protagonist*innen nicht als literarische Artefakte, sondern als Gebrauchs- oder Ratgeberliteratur zu verstehen scheinen. Nur um dann einigermaßen erstaunt zu sein, dass die Hölle sich in Texten anders darstellt als in ihrem Erleben.
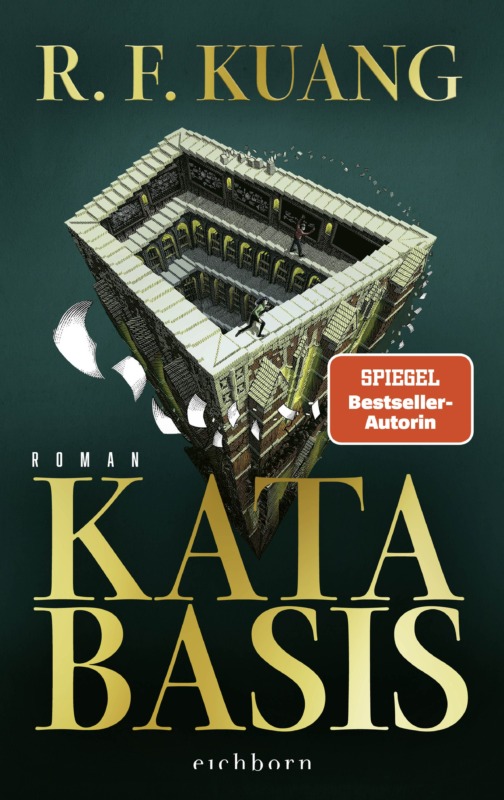
Zum anderen verweist der Roman durchgängig auf den britischen Campus- oder College-Roman, der vor allem durch David Lodges Werk aus den 1970er und 1980er Jahren und später durch Zadie Smith populär wurde. Während Lodge noch humorvoll-ironisch mit akademischen Konventionen, Konkurrenz und Liebeleien auf die Institution Universität blickt, stehen bei Smith die ironische Dekonstruktion und Kritik am akademischen Betrieb im Vordergrund. Kuangs Roman hat hier das Potenzial einen weiteren Akzent zu setzen, in dem er bei den College-Beschreibungen stark auf die Schattenseiten von Academia fokussiert: prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Abhängigkeit und Machtmissbrauch in hierarchisch geprägten Strukturen, Selbstausbeutung und Burnout.
»Die Hölle ist ein Campus«
Dieses Potenzial bleibt leider ungenutzt und trägt letztlich nur zur weiteren Romantisierung des akademischen Betriebs bei. Bei der Höllendarstellung handelt es sich in Teilen nur um ein Spiegelbild des Campus’ von Alices und Peters College in Cambridge. Kein Wunder, dass Peter irgendwann »Die Hölle ist ein Campus« über die Lippen geht. Damit ist das eigentliche Thema ziemlich platt benannt, für den Plot bleiben zentrale Fragen jedoch unbeantwortet. Warum steigen etwa die Protagonist*innen in die Hölle, wenn doch Doktorvater Grimes eher dem Bild eines eitlen, übergriffigen und abgehobenen Wissenschaftlers – einem Höllenfürsten sozusagen – gleicht und der Campus nur die Hölle ist? Derlei behauptete Konstellationen machen das Narrativ unglaubwürdig.






Eingebettet ist dieser wilde Mix ins Genre des magischen Realismus, in dem das Übernatürliche zwar in die Realität einsickert, aber dadurch eine fiktive Welt erschaffen wird, die in sich geschlossen ist und ihren Regeln gehorcht. Das ist in Kuangs »Katabasis« jedoch nicht gegeben. Die einzelnen Ebenen von Höllenliteratur, Campus-Roman und magischer Realismus bieten kein neues, stimmiges Bild, sondern geraten in ein wildes literarisches und literaturgeschichtliches Durcheinander. Kuang zieht mythologische Motive, Zitate, gelehrte Anspielungen und pseudo-philosophische Einschübe so hemmungslos durch den Schredder, dass am Ende anstelle eines geschlossenen Universums ein völlig chaotischer, akademischer Zettelkasten übrig bleibt.
Wurde in »Babel« noch eine wirklich kluge Gleichung aus Sprache, Macht und Moral aufgestellt, bleibt »Katabasis« in seinen Phrasen eine hohle Behauptung. Einen solchen Text, der ehrgeizig und klug sein will, aber letztlich doch nur ein völlig stereotypes Narrativ der Höllenreise ist, hätte auch von einer KI zusammengeschustert sein können. Dieser Eindruck wird noch dadurch gesteigert, dass der mit intertextuellen Anspielungen und philosophischen Einlassungen überladene Text sprachlich weit hinter den eigenen Ansprüchen zurückbleibt. Oft hochtrabend, stellenweise unfreiwillig komisch ist der Text langatmig und immer wieder schrecklich banal. Die permanent um einen pseudoakademischen Ton bemühte Übersetzung von Alexandra Jordan und Heide Franck ist da leider auch nicht hilfreich.
Kuangs Höllenvision ist keine Metapher, sondern ein verzerrtes Spiegelbild der eigenen akademischen Hybris. Der Roman hätte eine scharfsinnige Satire über die geschlossene Welt der Universitäten und somit ein Beitrag zu den aktuellen Debatten über Machtmissbrauch und Prekariat im akademischen Betrieb werden können. Das wäre nicht nur ungleich spannender, sondern vor allem auch relevant gewesen. Er hätte auch ein eskapistisches Lesevergnügen werden können. Doch Kuang lässt ihre Leser*innen über 560 lange Seiten in den acht Vorhöfen der Absurditäten mit Figuren schmoren, die referieren, zitieren und wetteifern und die sich letztlich in ihrer eigenen akademischen Selbstverliebtheit um jede Glaubwürdigkeit »salbadern«.
Letztlich ist »Katabasis« ein überfrachteter Text, der einem akademischen Overkill gleichkommt. Vielleicht dient der Roman als Mahnung, dass selbst die besten literarischen Quellen und Traditionen zum Höllentrunk werden, wenn man sie einfach nur wild zusammenrührt.