Am Ende zahlt der kleine Mann. Diese Logik gehört zu den vermeintlichen Wesensmerkmalen der neoliberalen Ordnung. Marcel Fratzscher, Wolfgang Streeck und Robert Misik denken über soziale Ungleichheiten, das Ende des Kapitalismus und die Wiedergeburt der Sozialen Marktwirtschaft nach.
Der Betrug um die Abgasnormen von Dieselmotoren, der unter dem Schlagwort #Dieselgate weltweit in den Schlagzeilen war, kommt dem VW-Konzern teuer zu stehen. Mehr als 16 Milliarden Euro hat das Unternehmen für die Kosten der Dieselaffäre zurückgestellt. Ob dieser Betrag reichen wird, ist unklar. Die Vorstandsmitglieder haben trotz dieses moralischen und finanziellen Desasters auf ihre Boni nicht verzichtet. Lediglich 5,6 von insgesamt 63,2 Millionen Euro, die den Gesamtbezügen der Vorstände entsprechen, wurden auf Eis gelegt. Entwickelt sich der Kurs der Aktie wider Erwarten gut, werden Teile der variablen Vergütung 2019 doch noch ausgezahlt. Wie man zur positiven Entwicklung von Aktienkursen beitragen kann, ist hinlänglich bekannt: Man verringert die Belegschaft! Am Ende des Spiels könnte es sein, dass die Vorstände, die Verantwortlichen von Dieselgate, ihre Boni dadurch erhalten, dass sie einfache Mitarbeiter entlassen. So funktioniert der Kapitalismus im 21. Jahrhundert.
Es ist kein Wunder, dass dieser real existierende Kapitalismus immer stärker hinterfragt wird. »Es bedarf weder der utopischen Vision einer alternativen Zukunft noch übermenschlicher Voraussicht, um auf den Gedanken zu kommen, dass der Kapitalismus seiner „Götterdämmerung“ entgegensieht«, schreibt etwa der Sozialforscher Wolfgang Streeck. Der »Kapitalismus« wird als politische und wissenschaftliche Kategorie gerade neu entdeckt, nachdem er infolge des Zusammenbruchs der kommunistischen Wirtschaftssysteme in der Sowjetunion und in Osteuropa in die Krise der Alternativlosigkeit geraten ist. Er muss nicht mehr erklärt oder hinterfragt werden, denn mit dem Untergang des Kommunismus ist ihm sein Antipode, an dem er durch Reibung gesunden könnte, abhanden gekommen. Fatal, denn dieser Weltenwandel hat weder das Ende der Geschichte eingeläutet noch zu größerer Gerechtigkeit geführt. Die Art, wie wir wirtschaften, hat nicht nur gefühlte Ungerechtigkeit und Ungleichheit hervorgebracht, sie sind empirisch nachweisbar. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hat dies in seinem Buch Verteilungskampf – Warum Deutschland immer ungleicher wird in vielerlei Hinsicht belegt.

Laut Fratzscher herrscht, bezogen auf Einkommen, Vermögen und Chancen, in kaum einem Industrieland eine so hohe Ungleichheit wie in Deutschland. Was die privaten Vermögen angeht, so geht er in seinem Buch der Frage nach, wieso diese in Deutschland so gering sind. In keinem anderen Land Europas seien die Privatvermögen für so viele Menschen derart niedrig und gleichzeitig so ungleich verteilt wie hier. Selbst die Vermögensarmut sei hierzulande wesentlich größer als in den USA, weshalb Deutschland das ungleichste Land Europas sei. Und dies, so argumentiert der Wirtschaftsexperte, obwohl die offiziellen Zahlen eher konservativ berechnet werden und die tatsächliche Ungleichheit signifikant größer sein könnte.
Dies hänge eng mit der Einkommensstruktur zusammen und mache das Dilemma der unteren 40 Prozent der deutschen Gesellschaft aus. Aus Sicht der Arbeitnehmenden ist die Lohnentwicklung in Deutschland in den vergangenen 25 Jahren enttäuschend verlaufen. Fratzscher zeigt, dass die deutschen Reallöhne heute im Durchschnitt kleiner sind als 1990. Die Zuwächse der wirtschaftlichen Leistung, die im letzten Vierteljahrhundert erreicht wurden, sind hauptsächlich den Vermögenden zugute gekommen, was die viel beachteten Thesen des französischen Ökonomen Thomas Piketty bestätigt. 1985 gehörte die Bundesrepublik noch zu den Ländern, in denen die Ungleichheit in fast allen Lohn- und Einkommensarten geringer war als im Durchschnitt der OECD-Länder. Dies habe sich in den vergangen drei Jahrzehnten fundamental gewandelt. Der Anstieg der Ungleichheit, was die Einkommen angeht, habe weniger mit dem Reicherwerden der Reichen zu tun als vielmehr mit einer Verarmung der Armen, erklärt Fratzscher.
Diese Ungleichheiten setzten sich in der sozialen Mobilität fort. Deutschland weise eine geringe Einkommens- und Vermögensmobilität auf. Die soziale Mobilität, jenes identitätsstiftende Versprechen der sozialen Marktwirtschaft Deutschlands, sei im internationalen Vergleich außergewöhnlich gering. Vor allem aber sei sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten nochmals deutlich gesunken!
Diese Argumente ziehen sich als Leitmotive durch das Buch, Fratzscher selbst spricht von einem Mantra: Die Bundesrepublik Deutschland ist für ihn aus vielen Perspektiven das ungleichste Land Europas. Nun könnte man spitz nachrechnen, ob dies denn tatsächlich der Fall ist. Ob das Vaterland der Sozialen Marktwirtschaft wirklich ungleicher ist als das Mutterland des Neoliberalismus oder als der Staat der realexistierenden blockierten Gesellschaft? Ganz möchte man das nicht glauben. Es wäre zugleich eine müßige Debatte, denn die wesentlich wichtigere Botschaft, die Fratzscher seinen Leser*innen näherbringt, ist der Beleg, dass die Thesen Pikettys nicht im luftleeren, akademischen Raum umherschwirren, sondern real greifbar sind. Die ungleiche Verteilung von Vermögen, Einkommen und Mobilität schafft eine weitere, ungleichere Verteilung von Vermögen, Einkommen und Mobilität. Und dies hat schwerwiegende Konsequenzen. Der Autor zählt neun auf, von denen die Reduktion des Wirtschaftswachstums durch die wachsende Ungleichheit zentral erscheint. Fratzscher führt damit eine der wesentlichen Behauptungen neoliberaler Ökonomen ad absurdum, nämlich die, dass wirtschaftliche Ungleichheit zu einer größeren Wirtschaftsdynamik führe, die wiederum über Trickle-Down-Effekte allen zugute komme. Der DIW-Präsident behauptet stattdessen, die Wirtschaftsleistung in Deutschland »hätte um knapp ein Fünftel stärker sein können, wäre die Einkommensungleichheit in Deutschland nicht gestiegen.«
Fratzscher – Mitglied der Glienicker Gruppe, einem Zusammenschluss deutscher Ökonomen, Juristen und Politologen – ist zum Glück ein politischer Mensch. Er benennt nicht nur Probleme, sondern skizziert auch Handlungsempfehlungen. Sie könnten mutiger sein, frecher formuliert und revolutionärer anmuten, im Hinblick auf einen Bundestagswahlkampf, der nächstes Jahr stattfindet, sind sie dennoch von Bedeutung. Der Präsident des DIW möchte durch Investitionen in die frühkindliche Bildung die Chancengerechtigkeit erhöhen, schlägt eine geringere, aber effizientere staatliche Umverteilung vor, möchte die Bevölkerung in Deutschland darin unterstützen, eigenes Vermögen, etwa durch eine Eigenheimförderung, aufzubauen und – passend zur aktuellen Lage – Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integrieren. Das ist eine mehr als solide sozialliberale Programmatik, gerade deshalb wird er auch als »Haus- und Hofökonom« des deutschen Wirtschaftsministers und SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel bezeichnet. Zu dessen Agenda passt auch der Name des Buches. Verteilungskampf hört sich nach Kuscheln mit der SPD-Basis an, enthält aber kluge, pragmatische Vorschläge, mit denen ein SPD-Kanzler das soziale und wirtschaftliche System der Bundesrepublik Deutschland reparieren könnte.
Ob dieses System überhaupt noch zu reparieren ist, stellen andere Autoren in Frage. Am provozierendsten wohl Wolfgang Streeck, der ehemaligen Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung. Er hatte 2013 mit Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus ein vieldiskutiertes, analytisch brillantes Buch über die Finanz-, Wirtschafts-, Institutionen- und Politikkrise der EU geschrieben, das in den Empfehlungen leider zu stark im nationalstaatlichen Rahmen verhaftet blieb. Im Jahre 2014 hatte Streeck vor der British Academy eine Lecture gehalten, die unter dem Titel Wie wird der Kapitalismus enden? in den Blättern für deutsche und internationale Politik in zwei Teilen (Teil 1, Teil 2) veröffentlicht wurde. Schon allein die Fragestellung, nicht ob, sondern wie der Kapitalismus endet, charakterisiert die intellektuelle Lust zur Provokation dieses aufregenden Antimainstream-Analytikers. Er begründet seine These mit der Analyse von drei Langzeittrends: »Da ist erstens der anhaltende, durch die Ereignisse von 2008 noch verschärfte Rückgang des wirtschaftlichen Wachstums. Zweitens gibt es, verbunden hiermit, einen ebenfalls anhaltenden Anstieg der Gesamtverschuldung in führenden kapitalistischen Volkswirtschaften, in denen Regierungen, Privathaushalte und Unternehmen der Finanz- und Realwirtschaft vierzig Jahre hindurch finanzielle Verbindlichkeiten angehäuft haben. Drittens nimmt während die Verschuldung ansteigt und die Wachstumsraten sinken, die Ungleichheit sowohl der Einkommen als auch der Vermögen ebenfalls schon jahrzehntelang zu.«

Rückgang des wirtschaftlichen Wachstums, wachsende Verschuldung und steigende Ungleichheit ist ziemlich exakt das Gegenteil dessen, was die kapitalistische Wirtschaftsordnung legitimiert hat, nämlich stetiges Wachstum, stabiles Geld und ein gewisses Maß an sozialer Gleichheit. Gibt es, so fragt sich Streeck, irgendwelche Anzeichen, dass sich diese drei Trends umkehren könnten? Er kann und will sie nicht erkennen. So kommt er zur Einsicht, dass über ein Ende des Kapitalismus nachzudenken sei, ohne sich dabei in die Pflicht nehmen zu lassen, eine konkrete Alternative zu erarbeiten. Das Ende des Kapitalismus sei nicht mehr und nicht weniger als das Ableben eines »chronisch funktionsgestörten Gesellschaftssystems«. Keiner wisse genau, wann und wie der Kapitalismus verschwindet oder gar, was nach ihm kommen könnte.
Diese Selbstauflösung und Selbstzerstörung hängt auch damit zusammen, dass es keine Gegenkraft mehr zur kapitalistischen (Un)Ordnung gibt. Es fehlt eine Opposition, die ihn in jenem Maße lern- und wandlungsfähig gehalten hat, wie es Luc Boltanski und Eve Chiapello in ihrem Buch Der neue Geist des Kapitalismus Ende der 1990er Jahre beschrieben hatten. In den 70er und 80er Jahren hatte das westliche Wirtschaftssystem die Kritik und die Anregungen der künstlerischen Avantgarde der 68er-Bewegung aufnehmen und produktiv für sich wenden können. Allerdings hatten die beiden Autoren damals schon vorhergesehen, dass wachsende Gerechtigkeitsdefizite augenfällig werden.
Der Untergang des Kommunismus, seine stille Implosion in den Jahren seit 1989, die Francis Fukuyama verführten, das Ende der Geschichte herbeizufantasieren, habe sich als Pyrrhussieg erwiesen, schreibt Streeck, »weil er ihn von ebenjenen Gegenkräften befreite, die ihm zwar gelegentlich unbequem, tatsächlich aber seiner Fortexistenz stets dienlich gewesen waren«. Der Kapitalismus sei ohne Kritik und ohne Gegenkräfte auf seine eigenen Mittel angewiesen, zu denen Selbstbeherrschung und Zurückhaltung eben nicht gehören. Dem Kapitalismus gegenwärtiger Prägung fehlt das, was Edward P. Thompson in seinen Aufsätzen zur englischen Sozialgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts Plebeische Kultur und moralische Ökonomie als »moral economy« beschrieben hat. Streeck zufolge sind es fünf Funktionsstörungen, die den Tod des Kapitalismus durch Überdosis an sich selbst hervorrufen. Diese Störungen sind nachlassendes Wachstum, Oligarchie, Aushungerung der öffentlichen Sphäre, Korruption und internationale Anarchie. Moralisch ist diese Ökonomie nicht. Aber im Augenblick der Gier enorm erfolgreich. VW lässt grüßen!
Streeck prognostiziert »eine lange und schmerzhafte Periode kumulativen Verfalls«, in der die Haupt- und Nebenwidersprüche des wirtschaftlichen Systems zu seinem eigenen Ende führten. Vielleicht ist das Ende des Kapitalismus mit dem ökonomischen Niedergang des Ostblocks zu vergleichen, ohne dass allerdings systemstabilisierende Maßnahmen wie Milliardenkredite durch das gegnerische System möglich sind. Ein Franz-Josef Strauß ist nicht in Sicht. Stattdessen erscheint Pyrrhus als Tragödie und Farce in einer Person.
Neben dem Gesellschaftsforscher bescheinigt ein weiterer Autor dem Kapitalismus sein Ende. Weniger analytisch als vielmehr wütend, weniger deskriptiv als vielmehr wertend, geht Robert Misik der Frage nach, ob der Kapitalismus sterben wird und wenn ja, ob uns dies glücklich machen würde. Mit Kaputtalismus. Wird der Kapitalismus sterben und wenn ja, würde uns das glücklich machen? ist der erste Teil der Frage bereits beantwortet. Ja, der Kapitalismus wird sterben, weil er eben kaputt ist. Ökonomisch, sozial, moralisch. Er ist kaputt und lässt sich nicht mehr reparieren.
Seine Analyse zur gegenwärtigen Situation des Kapitalismus’ weist etliche Parallelen zu Streeck auf. Mit der Emphase der Kreation von Kaputtalismus stellt er die Frage, »ob ein System, das aus seiner inneren Logik heraus dermaßen auf Dynamik und Expansion angelegt ist wie das kapitalistische, in einem Zustand ohne Expansion überhaupt weiterexistieren kann?« So klug wie die Frage, so wenig differenziert sind seine Antworten. Die intellektuelle Tiefe von Wolfgang Streeck ersetzt Misik mit klaren Feindbildern. Das Böse ist der Neoliberalismus, er hat so ziemlich alles falsch gemacht, was man nur aus Bosheit falsch machen kann. Linke Wirtschaftsrezepte hätten hingegen die Welt gerettet, wären sie denn angewandt worden. Wurden sie aber nicht und so sitzt der Kapitalismus heute in der Patsche.
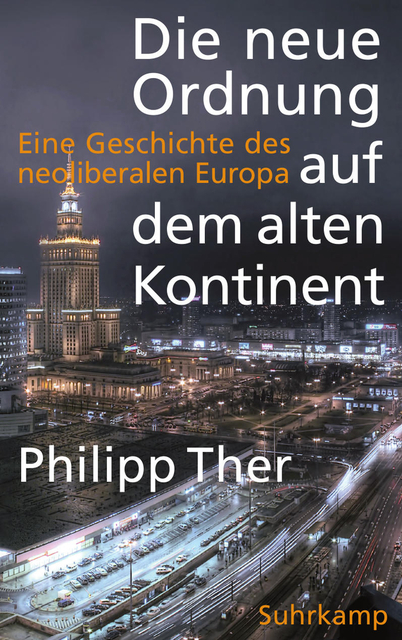
Nun ist das Gegenteil von falsch noch lange nicht richtig. Misiks unterkomplexe Sicht auf die Dinge und speziell auf den Neoliberalismus verstellen ihm einen peniblen analytischen Zugang. Und man wünschte sich, dass er einmal das Buch des Wieners Historikers Philipp Ther in die Hände genommen hätte. Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent, ausgezeichnet mit dem Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse anno 2015, ist die Geschichte des neoliberalen Europas. Misik hätte darin lernen können, dass der Neoliberalismus nicht vom Himmel fiel, sondern eine spezifische historische Verortung hatte. Die ökonomischen Rezepte des Keynesianismus, Misiks Heil- und Wunderökonomie, wirkten zu Zeiten einer Stagflation nicht mehr, die durch die wirtschaftlichen Verwerfungen infolge der Ölkrise in den 70er Jahren, durch die Rezessionen Anfang der 1980er Jahre und durch die steigenden staatlichen Budgetdefizite verursacht wurden. Margret Thatcher und Ronald Reagan waren ökonomisch nur Kinder ihrer Zeit und versuchten mit neuen, heute würde man sagen, innovativen wirtschaftlichen Rezepten, ihren kränkelnden Volkswirtschaften auf die Beine zu helfen. In den nicht-angelsächsischen Ländern versuchten Christ- wie Sozialdemokraten den Wohlfahrts- und Fürsorgestaat im Sinne der sozialen Marktwirtschaft aufrechtzuerhalten – allerdings zum Preis eines deutlich schwächeren Wirtschaftswachstums. Auch deshalb avancierten neoliberale Ideen zum Mainstream. Der Neoliberalismus hatte seinen historischen Sitz in der Erkenntnis, dass die Rezepte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Weltwirtschaft der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht mehr funktionierten. Sie werden auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht mehr funktionieren. Auch der Keynesianismus ist kaputt. So sympathisch John Meynard Keynes einem auch sein mag, so intelligent und klug er immer auch war – seine Zeit ist vorbei. Schade, dass Misik das nicht berücksichtigte, als er sein Buch schrieb.
Dabei spricht Misik richtige Punkte an. Den Fetisch einer Wettbewerbsideologie, die Dominanz der tendenziell instabilen Finanzmärkte, die gleichzeitig die tendenziell stabilisierenden Gütermärkte verdrängt haben, und die mit diesen Entwicklungen einhergehende Konzentration von Reichtum. Dies sind große, relevante Probleme, die das gegenwärtige Wirtschaftssystem zum Scheitern bringen. Auf einen weiteren, wichtigen Punkt verweist er mit der nachlassenden Dynamik an Innovationen, die früher Produktivitätssteigerungen hervorgebracht hätten. Der technologische Fortschritt, der sich mit dem Begriff Digitalisierung verbindet, habe einen gehörigen Fortschritt der Bequemlichkeit verschafft. Die letzten fünfzehn Jahre hätten vor allem Produkte hervorgebracht, mit denen man das machen kann, was man schon vorher tun konnte, nur seien sind nun kleiner, smarter und schicker. Ein Fortschritt, der ins Leere läuft. Gleichzeitig sei offensichtlich, dass die Technologien, die neu entstehen, heute mehr Jobs zerstören, als sie schaffen. Gerade jene mit geringen und schlechten Qualifikationen würden so abgehängt. Selbst die Sicherheit, in der sich Hochschulabsolventen und Akademiker wiegen, sei nur eine vorläufige. Und tatsächlich, schon heute wird das Ende von so illustren Berufen wie Rechtsanwälten und Ärzten prophezeit. Und natürlich möchte man in zehn oder zwanzig Jahren lieber von Med-Rob oder irgendeinem anderen medizintechnischen Roboter untersucht werden als von einem übernächtigen Arzt in der dritten Doppelschicht der Woche. Und dass ein klug geschriebener Algorithmus deutlich schneller als jeder Rechtsanwalt tausende von Seiten analysieren kann, muss nicht eigens erwähnt werden.

Die Stärke des Buches sollte erwähnt werden. Anhand mehrerer Aufenthalte in Griechenland und Spanien beschreibt Misik fein beobachtend, wie lokale Ökonomien sich sukzessive in ein System des solidarischen Wirtschaftens verwandeln. Kooperationen, Genossenschaften, selbst verwaltete Unternehmen und dezentrale Netzwerken entstünden bereits. Der »Post-Kapitalismus« als eine »Miteinander-Ökonomie« zeichne sich bereits ab, wir müssten nur genau hinsehen.
Ob dieser Post-Kapitalismus die Welt des Wirtschaftens wirklich besser macht, ist noch offen. Nicht zu hoffen ist, dass er Selbstausbeutung und abgehängte, lokale Ökonomien legitimiert. Die Erfahrungen, die Misik gesammelt hat, sind kleinräumig, befinden sich weit entfernt von den ökonomischen Hotspots, an denen gigantischer Reichtum generiert und weiterhin nach oben verteilt wird. Und das Spiel derjenigen, die den Kapitalismus als Soziale Marktwirtschaft moralisch unterminiert haben, geht weiter.
Ein ökonomischer Gegenentwurf, der weder ins Nationale, wie man es so oft in den jüngsten Publikationen von Wolfgang Streeck entdecken kann, noch ins Kleinräumige oder Periphere wie bei Misik abgleitet, steht noch aus. Das Ende des Kapitalismus haben schon etliche prophezeit, wir arbeiten uns immer noch an ihm ab. Sollten wir dann hoffen, dass das System doch noch zu reparieren ist, wie es Marcel Fratzscher vorschwebt? Vielleicht ist das gar nicht die relevante Frage, sondern vielmehr, wie Politik in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen wieder das Primat erlangen kann. Es geht nicht um eine marktkonforme Demokratie, sondern um eine demokratiekonforme Marktwirtschaft, um die tatsächliche Umkehrung von Angela Merkels Mal-mot in ein tatsächliches Bonmot. Es geht um die Chance, mit ökonomischem Risiko Gewinne zu machen, wissend, wirtschaftlich auch scheitern zu können.
Dafür braucht es die Rückbesinnung auf eine »moral economy« als vorrangiges Prinzip der gegenseitigen Unterstützung. Mit der Bereitschaft und dem moralischen Ethos, Verantwortung zu tragen und sie nicht auf Schwächere abzuwälzen. Das heißt, die neoliberale Logik des Sozialisierens der Verluste und des Privatisierens der Gewinne umzukehren und Solidarität nicht nur in engen oder nationalen Grenzen zu üben, sondern auch und vor allem in internationalen Kontexten. Es ist genug für alle da. Ob wir eine solche ethisch fundierte Ordnung »Post-Kapitalismus« oder anders nennen, sei dahingestellt. Es wäre dann auch nicht mehr wichtig.


[…] Grundlage unserer sozialen Marktwirtschaft, lässt sich kaum noch realisieren. Folgt man dem Buch Verteilungskampf von Marcel Fratzscher, herrscht – bezogen auf Einkommen, Vermögen und Chancen – in kaum einem Industrieland eine so […]
[…] Ist nicht genug für alle da? […]