Kaum ein Schriftsteller von seinem Gewicht ist so schnell in Vergessenheit geraten, wie Thomas Brasch. Zahlreiche Bücher und ein Kinofilm ermöglichen es, sich auf ganz unterschiedliche Weise dem 2001 verstorbenen Dichter anzunähern.
»Land ohne Namen, das sich ansprechen lässt mit Anfangsbuchstaben,
umgeben von einer Mauer, unter dem schweren märkischen Himmel,
wanken die Dreher durch deine Straßen in deine Fabriken zum Fleiß (Artur ist schon in der S-Bahn besoffen)
O Kreuzung zwischen Knast und Irrenanstalt, in deinen Werkhallen
wird die große Müdigkeit produziert, in deinen Fernsehstudios
werden die Träumerein von Idioten verfilmt, aus deinen Rundfunkstationen
klingt das Lulalu und wiegt die Hörer in den großen Schlaf.«
»Schließlich war es richtig, alle vorschläge abzulehnen, meinen gefängnisaufenthalt oder meinen weggang aus der ddr oder die kadettenschule als ‚literatur’ zu verwursten oder zu sensationalisieren.« Mit diesen Worten zitiert die Germanistin und Programmleiterin des Literaturhauses in Köln, Insa Wilke, den Dichter Thomas Brasch in ihrem sein Werk analysierenden Essay »Ist das ein Leben«. Spätestens seit der Zahlenmystiker Thomas Brasch von der Notiz Carl Philipp Emanuel Bachs auf den Bögen von »Die Kunst der Fuge« wusste, in der es heißt, dass Johann Sebastian Bach über dem Schreiben an der Fuge mit dem Thema B-A-C-H gestorben sei, war ihm das Öffentlich-Machen der eigenen Lebensgeschichte, des Selbst, unmöglich, da sie »zum Tod führen« müsse. Selbst das Angebot eines interessierten New Yorker Verlegers, für 200.000 US-Dollar die Rechte an einer um die 800 Seiten starken Autobiografie zu kaufen, konnte Brasch nicht ausreichend motivieren, diese zu schreiben. Doch wenngleich der Dichter und Dramaturg keine Autobiografie verfasst hat, ist doch jedes Wort autobiografisch motiviert, spricht sein Leben aus seinem Werk und begründet sich sein Werk in seinem Leben, wie anhand von Insa Wilkes Essay noch zu zeigen sein wird.
Insa Wilkes bereits 2010 erschienenem Essay ermöglicht gemeinsam mit dem Dokumentarfilm »Brasch. Das Wünschen und das Fürchten« von Christoph Rüter sowie zwei wichtigen Neuauflagen aus dem Brasch’schen Œuvre die Wiederentdeckung eines der beeindruckendsten deutschen Autoren, Dramatikers, Regisseurs und Intellektuellen. Während der Band »Vor den Vätern sterben die Söhne« die direkte Suche nach dem rebellisch-wütenden Thomas Brasch in seinem literarischen Erstlingswerk ermöglicht, zeigen Christoph Rüter sowie die Gedichtsammlung »Die nennen das Schrei«, wie der aus Ostdeutschland ausgereiste Dramaturg an seinem Leben zwischen den beiden deutschen Staaten litt und dies insbesondere sein Spätwerk beeinflusste. Die Germanistin Insa Wilke deutet und interpretiert in ihrem Essay Braschs Werk und präsentiert ihren Lesern einen Autoren, der nicht nur mit Bertold Brecht, Isaak Babel, Georg Heym, Robert Musil und Thomas Bernhard in einer Reihe stehen wollte, sondern der diesem Anspruch in seinem Gesamtwerk einen Ort gegeben hatte.

Thomas Brasch ist das wohl einzige deutsch-deutsche enfant terrible. Als Sohn des ehemaligen stellvertretenden DDR-Kulturministers Horst Brasch verließ er 1976 gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Katharina Thalbach die DDR, um in der BRD seine Werke zu veröffentlichen, um sie mit der Öffentlichkeit konfrontieren zu können. Schonungslos ging er dabei mit den gesellschaftlichen Verhältnissen in Ost und West in die Kritik. Rücksicht nahm er weder auf seine Leser noch auf sich selbst. Bis zum Exzess trieb er sein Schreiben und sein Leben. Eigentlich müssten sich längst Legenden um Brasch ranken. Ganz im Gegenteil aber ist er nahezu in Vergessenheit geraten.
Er wuchs als Sohn jüdischer Intellektueller in Cottbus auf, ging als jugendlicher – um seinem Vater zu gefallen – zur Kadettenschule der Nationalen Volksarmee in Naumburg (ein lebenslanges Trauma), probte später die Revolution gegen den eigenen regimetreuen Vater, suchte die Konfrontation mit ihm, protestierte laut gegen die Ausweisung Wolf Biermanns und initiierte eine Flugblattaktion anlässlich des Einmarschs sowjetischer Truppen in Prag 1968. Das Publizieren in der DDR wurde ihm wegen dieser Aktionen untersagt, weshalb er in die BRD ausreist und dort sein schwieriges Verhältnis zum kapitalistischen Staat pflegt, mit dem er bis zum Schluss nicht warm werden wird.
Eine wichtige Rolle in Braschs Biografie nimmt sein Aufenthalt in der DDR-Kaderschmiede in Naumburg ein. Der junge Thomas wollte mit einer Ausbildung in diesem Drillinstitut seinen Vater beeindrucken und dessen Liebe ergattern. Vergeblich, wie sich später zeigen sollte. Die eintausend Tage in der menschenfeindlichen Kaderschmiede blieben wie Pech an und in Thomas Brasch kleben und prägten ihn für sein Leben – und machten ihn zugleich die konkreten Erfahrungen betreffend still und leise. Wie tief dieses Trauma saß, macht der 1979 verfasste Essay über Robert Musils »Törleß« deutlich, den Insa Wilke zitiert: »In dem die herrschende Klasse die kleinste Zelle des eigenen Staates, die Familie nämlich, zerstört (in der Hoffnung auf perfekt geschliffenen Nachwuchs), schafft sie sich den zukünftigen Feind: Der eigene Sohn, im Internat zum blutig geräderten, melancholischen Ödipus heruntergekommen und aufgestiegen, wird im nächsten Krieg als Offizierswerkzeug ohne wirklichen Standesstolz zerbrechen oder er wird den väterlichen Staat – beschreiben.«
All die Qualen und Entbehrungen in Naumburg brachten Vater (und Staat) und Sohn nicht näher zueinander. Verbunden blieben sie nur durch eine tief empfundene Hassliebe, geschürt auch von dem Verrat des Sohnes durch den Vater an die Stasi. Als Thomas Brasch seinem Vater 1968 gesteht, Flugblätter gegen den sowjetischen Überfall auf die Tschechoslowakei gedruckt und verteilt zu haben, greift dieser zum Telefon und lässt ihn von der Stasi abholen. Brasch wurde in einem Eilprozess zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, bereits 1969 aber schon auf Bewährung entlassen. Auch diese Haft verschloss Brasch tief in seinen Eingeweiden, gemeinsam mit dem abgrundtiefen Hass auf seinen Vater. In Christoph Rüters Dokumentarfilm kommentiert Brasch diese Erfahrung nur mit den knappen Worten »Knast ist zum Kotzen.« Diese Erfahrung wollte er nie wieder machen, auch deshalb floh er 1976 aus der DDR: »Zweimal einfahren in eine Wohnung ohne Klinken macht keinen Spaß.«
Aus dieser Erfahrung heraus ergibt sich, wie Insa Wilke deutlich macht, die poetologische Grundkonstellation für Braschs Werk: Nämlich die Frage, wie man vier Wände beschreiben kann, das eine Welt daraus wird? Diese vier Wände sind nicht nur ein Ort (das Gefängnis, die DDR, das Exil), sondern auch die Lebensumstände (der Staatssozialismus, der Staatskapitalismus, die Bedingungen des westdeutschen Kulturbürgertums) und das eigene (Über-)Leben darin. Sein Schreiben musste zur Unmöglichkeit werden. »Literatur muss doch immer wieder der Versuch sein, sich immer noch nackter machen zu können, aber nie sagen zu können, das ist das, was man eigentlich wollte.« In dieser Form wird für sein Schreiben charakteristisch, dass es sich der »theatralischen Brauchbarkeit« entziehen sollte. Für Brasch wird das Schreiben zum Erkunden des Unbekannten zwischen den vier Wänden. Die Ausreise aus der DDR dient nicht dem Entkommen aus diesem an den Seiten geschlossenen, aber nach oben offenen Raum, sondern dem Erreichen eines Ortes, der in alle Richtungen offen ist und wo er öffentlich über diese vier Wände und seine Position darin schreiben und publizieren darf. Die DDR und seine Erlebnisse in und mit dieser Gesellschaft will er nicht hinter sich lassen, sondern er will sie sich und seinen Lesern vor Augen führen können. Dies war nur außerhalb des sozialistischen Deutschlands möglich.
Von seinem egoistischen und so wenig liebenden Vater kommt er nie los. Die familiäre Liebe aller Ablehnung zum Trotz, diese in die Gene eingeschriebene Abhängigkeit, war Brasch zugleich auch Motivation zur bewussten Selbstkasteiung. In seinem Theaterstück »Lieber Georg« lässt er den seinen Dichtersohn verabscheuenden Vater fluchen: »Mit deinen Gedichten wisch ich mir den Arsch.« Womöglich liegt in dieser Hassliebe zum Vater Braschs Leidenschaft für Shakespeare begründet. Er übertrug zahlreiche Werke des englischen Dramatikers neu ins Deutsche. Womöglich wollte er dem englischen Dramatiker den Vatermord in »Richard III« entwenden, zu dem er selbst nicht in der Lage war.
Die Auseinandersetzung mit dem Vater war für Brasch ein Lebensthema. Das schwierige Verhältnis zwischen Thomas und Horst Brasch endet erst auf dem »Sozialistenfriedhof« in Berlin-Friedrichsfelde im Oktober 1989, wenige Wochen vor der Wiedervereinigung. Eingeklemmt in die Horst Brasch zu Grabe tragende DDR-Prominenz stand dort auch sein Sohn, der in Westdeutschland inzwischen zu den Granden des Kulturbetriebs gehörte. Es sei eine Frage des Anstands und des Respekts gewesen, zur Beerdigung des Vaters zu kommen, hatte Brasch gegenüber Christoph Rüter vor der Kamera erklärt.
Christoph Rüters Dokumentarfilm »über den Dichter, Schriftsteller und Filmemacher Thomas Brasch« bringt uns Brasch noch einmal besonders nahe, sicher auch, weil Rüter zu Braschs langjährigen Begleitern gehört. Er lernte ihn Ende der 1980er Jahre an der Berliner Volksbühne kennen, wo er als Dramaturg arbeitete. Für den Film wertete er zahlreiche Stunden eigenes Filmmaterial sowie Aufnahmen von Brasch selbst aus. Sie sind vielleicht die einzigen Dokumente, die als direkt autobiografisches Material von Brasch betrachtet werden können. Dennoch bleibt bis heute die Frage, warum dieser nie seine eigene Geschichte verarbeitet hat. Rüters beantwortete er diese Frage folgendermaßen: »Mit Flaubert glaube ich, dass wenn Schriftsteller anfangen, ihre Briefe zu veröffentlichen und ihre Tagebücher zu veröffentlichen und sich selbst zum Gegenstand zu machen, dann ist die Literatur wirklich am Ende.«
»Wer schreibt der bleibt
hier oder weg oder wo
Wer schreibt der treibt
so oder so.«

Dieses »Schreiben für die Öffentlichkeit« war einer der wichtigsten Gründe für Braschs Ausreise, in der seine Werke in der von ihm verfassten Form nicht erscheinen durften. Sein Prosaband »Vor den Vätern sterben die Söhne« wurde in der DDR nicht verlegt – wegen »DDR-untypischer Tristess«. Bei Insa Wilke liest man in einer Notiz zu einem Gespräch zwischen Brasch und seinem DDR-Verleger, was darunter zu verstehen ist: »Dr. Simon [der damalige Chelektor, I.W.] brachte zunächst seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass Thomas Brasch sich formal zwar an die gegenseitig abgesprochenen Änderungsvorschläge gehalten habe, andererseits aber so viel politisch-ideologisch Verschärfendes, Einseitiges in das Manuskript eingearbeitet habe, dass eine Veröffentlichung des Textes außerhalb jeder Möglichkeit und auch jeden Willens seitens des Verlages stehe.« An solche und ähnliche Gespräche, wie es dieser Notiz zugrunde lag, erinnerte sich Brasch lange. 1982 soll er sich an insgesamt 28 Änderungsvorschläge seinen Prosaband betreffend erinnert haben, »die so gewesen seien, als schnitte man ‚einem Mann die Nasen, den Schwanz und die Ohren’ ab«, erfährt man von Insa Wilke.
Rüters und Wilke widmen sich in ihren nicht-fiktionalen Brasch-Beiträgen der Frage, wie das Schreiben im inneren Exil eigentlich funktionieren konnte, wie Brasch sich und sein Schrifttum (oder seine Filme) immer wieder zur Verfügung stellte, um sich selbst und die Verhältnisse seiner Zeit einer breiten Diskussion zugänglich zu machen. »Schreiben heißt für mich, öffentlich Angst zu überwinden, oder es zumindest zu versuchen. Weil ich mit dieser Angst und diesen Wünschen nicht alleine bleiben will, möchte ich sie gerne sagen. Sonst machen sie mich zum Wrack. Wenn sie dauernd an mir nagen wie hungrige Ratten.«
Weil er in der DDR nicht in ein inneres Exil gefunden habe, aus dem er hätte öffentlich schreiben können, musste er ausreisen, schreibt Wilke. Er habe das tatsächliche Exil gebraucht, um schreiben zu können, »weil das für ihn auch hieß, öffentlich zu schreiben«, sein Denken und die Verhältnisse öffentlich zu thematisieren. Dies war in der DDR nicht möglich. »Vor den Vätern sterben die Söhne« wurde erst nach seiner Ausreise in Westberlin veröffentlicht und legte den Ursprung für seinen Siegeszug in der westdeutschen Kulturlandschaft Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre. Vor allem entzog er sich mit diesem Gedichtband dem Zugriff und der Verwendung durch das ostdeutsche Regime. »Ich / habe mein Ziel erreicht. Ich bin / unbrauchbar«, lässt Brasch die Selbstmörderin Nakry in seinem späteren Gedichtband »Der schöne 27. September« (stellvertretend) sagen.
Braschs Prosaband ist nun im Rotbuch-Verlag neu aufgelegt worden. Ausgerechnet, will man fast sagen, kehrt doch mit dieser Ausgabe Braschs Erstlingswerk zurück zu seinem Erstverlag im Westen. Das Team um Friedrich Christian Delius organisierte damals Braschs Ausreise nach Westberlin, um seinen Prosaband unzensiert publizieren zu können. Innerhalb von wenigen Tagen nach Veröffentlichung der Erstausgabe war der bis dato noch unbekannte Autor in der Bundesrepublik in aller Munde. Doch statt dankbar mit seinem Verleger weiterzuarbeiten, reiste Brasch innerhalb der ersten Woche nach Frankfurt/Main und unterzeichnete einen Vertrag mit Suhrkamp. »Nie bin ich von einem Autor so verraten worden«, erinnert sich Delius an diese Zeit. Brasch soll den Schritt damit begründet haben, dass er kein linker Autor und damit in einem linken Verlag falsch aufgehoben sei. Außerdem müsse er sich von Heiner Müller emanzipieren, der im gleichen Verlag verlegt wurde.
Nun aber ist der Band, nachdem er viele Jahre vergriffen war, wieder neu aufgelegt worden. Und die Kraft der Wut, die Brasch in diesen Band steckte, kann man noch heute daraus lesen. Etwa in einer Passage, in der sein junger Protagonist nach Berlin zurückkehrt und sagt: »Diese Stadt, in der ich geboren bin, und die mich nicht wiedererkannt hat. Wie sie an ihr Ende kommt, die denen die drin sind, allen Saft aussäuft, dass nur noch Verpackungen durch die Straßen taumeln.” Scharfe, auf den Punkt genau geschriebene, entblößende Zeilen wie diese machten Brasch blitzartig berühmt. Und fälschlicherweise zum geflohenen Dissidenten.
Wenngleich Barsch in Westberlin und später in den USA immense Erfolge feiern konnte, blieb in seinem Herzen doch immer eine unausgefüllte Lücke. Die einmal wahrgenommene Heimatlosigkeit umklammerte sein Herz und ließ es nie mehr los. Dies spielte später eine große Rolle, als sich Brasch zurückzog und zu dem »Professor der Aphasie« und zum »Sterbewitz« wurde, von denen er vorher in seinen unzähligen Gedichten schrieb.
Diese zusammengetragen haben Martina Hanf und Kristin Schulz. Ihr voluminöser Band »Die nennen das Schrei« enthält sämtliche zu Lebzeiten veröffentlichten Gedichte sowie zahlreiche Texte aus dem Nachlass Braschs. Der Band enthält auch das seit Jahren vergriffene Gedicht »Kargo. 32. Versuch auf einem untergehenden Schiff aus der eigenen haut zu kommen«, wegen dem er 1977 vom Rotbuch-Verlag zu Suhrkamp wechselte. Die Kategorie Gedicht ergreift in diesem Fall nicht ansatzweise, was den Leser hier erwartet. Es ist eine dichte, zugespitze Komposition aus Lyrik, Prosa, Fotos, Szenen und Gesprächen, die alle für sich und doch in einem seltsam gelagerten Zusammenhang stehen und dabei die vordergründige Erzählebene überschreiten. »Sie laufen los. Schüsse. Zwei fallen.« Mit diesen knappen Abschlusssätzen beendet Brasch eine historische Passage in diesem Werk. Sie stehen abgesetzt, kursiv – jeder Leser kann sich denken, dass hier nicht mehr über Geschichte gesprochen wurde. Diese Zeilen darf man als Braschs unverhohlene Anklage der Mauerschützen deuten.

Die tiefgründige und mühsame Recherche-Arbeit, die Hanf und Schulz auf sich genommen haben, ermöglicht es, Thomas Brasch im Wandel der Zeiten und politischen Umstände, im Wandel seiner Erfolge und Niederlagen und – durch den vertiefenden Kommentar auch im Wandel der Rezeption seiner Werke immer wieder neu zu suchen. Dass man sich dabei verliert, ja geradezu verlieren muss zwischen den unzähligen Texten und Textfetzen, literarischen Geniestreichen und Bruchstücken, Notaten und Marginalien wie in einer bunten Zettelsammlung, liegt in der Natur der Sache – und bereitet der Faszination dieses Bandes keinerlei Abbruch.
Zu seinem schriftstellerischen Erfolg gesellt sich das Reüssieren als Filmemacher und Dramaturg. 1981 läuft sein erster Film »Engel aus Eisen«, eine kriminologische Erzählung zur Zeit der Berliner Luftbrücke, bei den Filmfestspielen in Cannes. Im selben Jahr erhält Brasch für sein »stilistisch konsequentes« Erzählen den Bayrischen Filmpreis. Thomas Brasch »filmt die subtile Studie von Menschen in einer aus den Fugen gefallenen Zeit«, hieß es in der Laudatio. Auf diese antwortete Brasch, der den Ärger seines Freundeskreises aufgrund der Entgegennahme des Preises aus den Händen des damaligen bayrischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß auf sich zog, mit folgenden Worten:
»Unter den Widersprüchen, die unsere Zeit taumeln lässt zwischen Waffenstillstand und Krieg, zwischen dem Zerfall der Ordnung, die Staat heißt, und ihrem wütenden Überlebenskampf, zwischen dem Alten, das tot ist, aber mächtig, und dem Neuen, das lebensnotwendig ist, aber nicht in Aussicht, scheint der Widerspruch, in dem ich arbeite, ein geringer – gleichzeitig ein Denkmal zu setzen dem anarchischen Anspruch auf eigene Geschichte, und dies zu tun mit dem Wohlwollen derer, die ebendiesen Versuch unmöglich machen wollen und müssen, der Herrschenden nämlich. Obwohl wie gesagt nicht der wichtigste Widerspruch, ist er doch für den, der ihm ausgesetzt ist, der mit dem Geld des Staates arbeitet und den Staat angreift, der den subversiven Außenseiter zum Gegenstand seiner Arbeit macht und sich selbst zur gleichen Zeit zu einem Komplizen der Macht, ein entscheidender: er ist der Widerspruch der Künstler im Zeitalter des Geldes schlechthin, und er ist nur scheinbar zu lösen – mit dem Rückzug in eine privatisierende Kunstproduktion oder mit der Übernahme der Ideologie der Macht. Beides sind keine wirklichen Lösungen, denn sie gehen dem Widerspruch aus dem Weg, und die Widersprüche sind die Hoffnungen. Erst sie ermöglichen den Bruch, der durch die Gesellschaft der Leistungen und der staatlichen Macht geht, und durch jedes einzelne ihrer Glieder in ihrer ganzen Größe, zu erkennen. Diese Gesellschaft hat sie geschaffen, hat die Künste in die Zerreißprobe zwischen Korruption und Talent geschleift, und nicht die Künste werden diesen Widerspruch abschaffen – sie können sich ihm nur aussetzen, um ihn besser zu beschreiben – sondern alle Kräfte, die zur Abschaffung der gegenwärtigen Zustände beitragen, die keine menschenwürdigen sind.«
Rüters zeigt die Sequenz der Laudatio und der Gegenrede (Hier im Video), in der Brasch den bayrischen Ministerpräsidenten mit dem italienischen Mafiaboss Al Capone vergleicht, in seinem Film fast in voller Länge, weil es auch die politische Position Braschs deutlich macht, der sich niemals zur pauschalen Regime-Kritik und schon gar nicht für eine mögliche Kapitalismusüberhöhung vereinnahmen lassen wollte.
Braschs erfolgreiches Schaffen in Westberlin drängt die tiefe Abscheu, die er gegenüber dem kapitalistischen Staat hegt – und wie sie in seiner Rede zum Filmpreis deutlich wird – in den Hintergrund. Innerlich wird ihm Westdeutschland nie warm. Wie zu seinem Vater verbindet ihn eine Hassliebe zur DDR. Insa Wilke vergleicht seine Erfahrung mit Westberlin mit der Pariserfahrung des ins Exil gezwungenen russischen Dichters Isaak Babel, der 1927 schrieb: »Alles ist sehr interessant, dringt mir aber, offen gestanden, nicht ins Herz. Das geistige Leben in Russland ist edler. Ich bin von Russland vergiftet, sehne mich, denke nur an Russland.«
Neben der Aufarbeitung der DDR-Erlebnisse und der Konfrontation mit seinem Vater spielt auch die Auseinandersetzung Thomas Braschs mit dem Dramaturgen Heiner Müller eine wichtige Rolle für den Zugang zu seinem Werk. Für Brasch scheint das Verhältnis zu Müller stets natürlicherweise konkurrierend gewesen. So liest zumindest die Germanistin Wilke die folgenden Worte: »Müller begann zu schreiben, als die heutige DDR noch ein Trümmerfeld war – ich begann zu schreiben, als die DDR ein funktionierender Staat war, um den eine Mauer stand.« Sowohl Müller als auch Brasch haben unter den Vorzeichen der deutsch-deutschen Teilung in ihren Stücken die Frage gestellt, wo sie als Intellektueller und Künstler in der Gesellschaft stünden und welche Rolle ihnen in dieser Position zukomme. Die Ergebnisse, angesichts der gegebenen Verhältnisse zu einer neuen Dramaturgie zu gelangen, hätten unterschiedlicher kaum sein können, wie Wilke anhand einer vergleichenden Analyse von Müllers »Hamletmaschine« und Braschs »Lieber Georg« deutlich macht: »Müller zertrümmert den Theaterraum in der Hoffnung, dass sich aus dem Schutt etwas Neues erhebe. Brasch erfindet den Theaterraum; ‚Hoffnung’ ist keine Kategorie für seine Arbeit, eher der ‚Wunsch’, der sich im Schreibprozess äußert.« Was Wilke hier beschreibt, ist nicht nur der Konflikt zweier Dramaturgen, sondern Ausdruck des Disputs, der die im geteilten und über die Grenze hinweg agierende Kulturszene Deutschlands tief geprägt hat.
In seinem Film kehrt Rüters immer wieder in die letzte Wohnung Braschs am Schiffbauerdamm zurück und diskutiert dort mit dem Dramatiker seine Situation und sein Scheitern an seinem Lebensprojekt, dem Brunke-Roman. Vom Anspruch her vergleichbar mit Musils »Mann ohne Eigenschaften« habe Brasch mit diesem Romanwerk um den Mädchenmörder Karl Brunke etwas schreiben wollen, was von Anfang an kaum eine Chance auf Vollendung hatte. Die Grunddaten dieses Mammutprojekts machen dies deutlich. Der Brunke-Roman ist ein Werk von unfassbaren Dimensionen. Über zehn Jahre hat Brasch immer und immer wieder daran gearbeitet, ganze Teile umgeschrieben oder neu gesetzt, bis er auf die schier unglaubliche Menge von 14.000 Manuskriptseiten angewachsen ist, die im Archiv der Berliner Akademie der Künste lagern und – ähnlich wie Arno Schmidts Monumentalwerk »Zettel’s Traum« es lange Jahre tun musste – auf eine Neuedition warten.
Vom Brunke-Roman sind einige tausend Blatt als riesiges Zettelkonvolut in Christoph Rüters Film unter Braschs Schreibtisch zu sehen. Und auch in dem Band der gesammelten Gedichte taucht Brunke immer wieder auf. Von der Brunke-Story tatsächlich erschienen sind jedoch nur knapp einhundert Seiten – Ende der 1990er Jahre herausgegeben von einem verzweifelten Siegfried Unseld, nachdem Brasch weder ein Ende seiner Erzählung fand noch einer Endfassung des bisher Geschriebenen und bereits Lektorierten zustimmen wollte.

Brasch und Brunke – mehr als ein Arbeitsverhältnis. In einem von Wilke entdeckten Tagebucheintrag spricht Brasch davon, sich »kotzebue-schwurgetreu zehn jahre lang ganz der selbstmörderischen prosa und dem selbstmörderischen mädchenmörder brunke verschworen« zu haben. Dass es Insa Wilke gelungen ist, diese prägnante Selbstbeschreibung noch stärker auf den Punkt – um nicht zu sagen, den Höhepunkt – zu bringen, indem sie zu dem Schluss kommt, dass sich Brasch an Brunke »ver-dichtet« habe, beweist ihre menschliche Weitsichtigkeit und sprachliche Eleganz. Die Auseinandersetzung und Deutung des Brunke-Romans und des Schaffensprozesses ist der Schluss- und Höhepunkt ihrer Vermessung von Braschs Werk in dessen Biografie.
In ihrem sehr zu empfehlenden Essay erschließt die Autorin nicht nur dieses monumentale Werk, sondern macht aus dem Leben des Autors und seinen Umständen Motivationen, Antriebe und Kontroversen deutlich. Ihr gelingt es, das alle Grenzen sprengende, radikale Literaturkonzept des Dichters Brasch wieder vor Augen zu führen und mit Leben zu füllen – und ganz nebenher noch die Frage nahe zu legen, warum ein deutscher Autor dieser Kraft so schnell in Vergessenheit geraten konnte. Wilkes Essay besitzt nicht nur die literaturtheoretische Tiefe, um sämtliche wissenschaftliche Ansprüche zu erfüllen, sondern auch die sprachliche Brillanz einer Erzählerin, die notwendig ist, um den Leser in eine andere Welt zu entführen. Literaturgeschichte wird hier nicht einfach nur erzählt, sondern (be-)greifbar gemacht. Wenn ein Werk dazu beitragen kann, dass Brasch als deutscher Dichter und Denker von Gewicht wiederentdeckt wird, dann ist es Insa Wilkes Essay »Ist das ein Leben«. Schon allein deshalb ist dieser tiefschürfenden und bislang einzigartigen Ergründung dieses Dichters und seines Werkes eine Vielzahl Leser zu wünschen. Und nicht zuletzt ist zu hoffen, dass sich irgendwo zwischen Suhrkamp (Braschs Verlag), Matthes & Seitz (Wilkes Verlag) und der Akademie der Künste eine Gruppe Interessierter findet, die eine Edition der 14.000 Manuskript-Seiten des »Brunke-Manuskripts « in Angriff nimmt.
Was Wilke nicht abdecken kann – einzig das existenzielle Ringen Braschs fernab der Literatur – erfährt der Interessierte in Rüters Film. Denn Brasch ging nach der Wiedervereinigung an seinem Dasein als Dichter zwischen den Welten – Werk geworden im Brunke-Roman – und den Begleiterscheinungen langsam zugrunde. Rüters vermag dies besser zu zeigen als jedes Buch, weil er sich dem Menschen zuwendet. Er konfrontiert den Betrachter nicht nur mit Braschs bis ins Mark zielenden Worten, sondern mit der bildgewordenen Realität des Dichterdaseins. Entsprechend zeigt er uns einen Brasch in permanentem Wandel, als hoffenden, 11-jährigen Kadetten neben seinem Vater, kritisch als jungen Autor in der DDR, gescheitert nach seiner Ausreise nach Westberlin, den Rebell Brasch neben Franz-Josef Strauß, den Intellektuellen im Gespräch mit Günter Grass, den Zweifler mit sich selbst und der Welt bis zum Schluss. Rüters zeigt, wie Thomas Brasch zu Thomas Brasch wurde – genau dies macht seinen Film sehenswert.
Braschs Werk sei eine »Signatur für den Tod einer Person [der Brasch der DDR, A.d.A.] und ihr Weiterleben [in Westdeutschland, A.d.A.] in und durch das Schreiben«, formuliert Insa Wilke. Und Brasch? Der brachte es ganz anders und doch ähnlich zu Papier:
»Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber
wo ich bin will ich nicht bleiben, aber
die ich liebe will ich nicht verlassen, aber
die ich kenne will ich nicht mehr sehen, aber
wo ich lebe will ich nicht sterben, aber
wo ich sterbe, da will ich nicht hin
bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.«

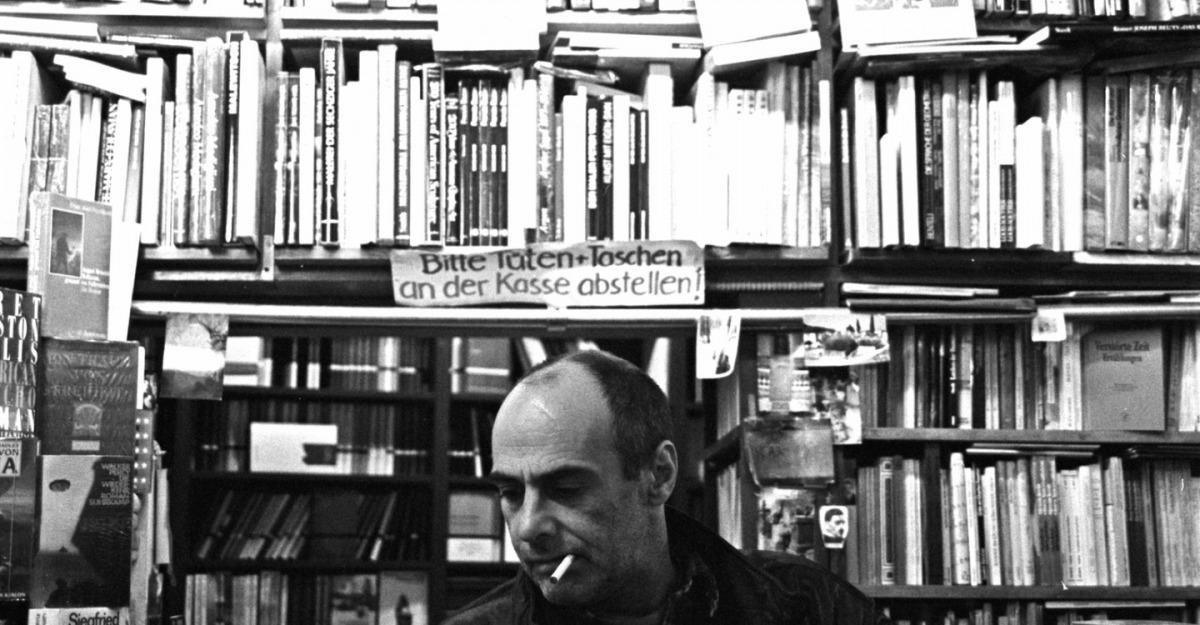
[…] motiviert, spricht sein Leben aus seinem Werk und begründet sich sein Werk in seinem Leben, wie Insa Wilke in ihrem vor knapp zehn Jahren erschienenem Essay gezeigt hat. Darin präsentiert die studierte Germanistin einen Autor, der nicht nur mit Bertold Brecht, Isaak […]
[…] Das Schreiben tritt in den Folgejahren in den Hintergrund, Brasch macht jetzt Film, und das nicht weniger erfolgreich. Das erzählt Kleinert in ziemlich großen Bögen, der Film wird hier sprunghaft, fasert geradezu aus. Vielleicht ist das aber auch Absicht, weil Kleinert hier nicht in Konkurrenz zum echten Brasch treten will. Den lässt Christoph Rüter in »Brasch. Das Wünschen und das Fürchten« ausführlich von diesen J… […]