Die amerikanische Schriftstellerin Lydia Davis gehört zu den besten Erzählern ihrer Generation. Im vergangenen Jahr hat sie den Man Booker International Prize für ihr Lebenswerk erhalten. Mit »Kanns nicht und wills nicht« liegen nun ihre neuen Erzählungen vor.
Eine junge Frau schreibt einen Brief an eine Stiftung, die sie mit einem Stipendium bedacht hat. Es ist ein recht langer Brief, obwohl die Autorin weiß, dass die Stiftung ihr Schreiben nicht erwartet – zumal die Förderung schon Jahre zurückliegt. Sie hat sich aber schon seit langem vorgenommen, der Stiftung zu schreiben, was das Stipendium in ihr und für ihr Leben ausgelöst hat. Von der Hoffnung, nicht mehr unterrichten zu müssen – »Ich will nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit einer großen Studentengruppe stehen« – und stattdessen Dinge tun zu können, die sie schon lange tun will, wie reisen, singen und tanzen. Sie berichtet von der Angst, doch nicht die Richtige für dieses Stipendium zu sein, und der daneben existierenden unerklärlichen Furcht, ihr könne etwas zustoßen und sie das Stipendium nicht in Anspruch nehmen. »War mein Leben aufgrund dieses Stipendiums auf einmal mehr wert?«, fragt sie sich in Ihrem Schreiben zurückblickend? Wohl nicht, denn am Ende ihres Schreibens stellt sie fest, dass sie für viele Existenzen und Ereignisse absolut überflüssig ist. »Es brauchte mich überhaupt nicht zu geben.«
Es sind Geschichten wie diese, die in dem neuesten Erzählungsband der Amerikanerin Lydia Davis Kanns nicht und wills nicht versammelt sind. Die Geschichten der 1947 geborenen Davis – die im vergangenen Jahr den Man Booker International Prize erhielt und sich dabei gegen andere renommierte Autoren wie Aharon Appelfeld, Marie NDiaye, Vladimir Sorokin oder Peter Stamm durchsetzte – sind formal höchst unterschiedlich. Mal kommen sie als aphoristische Einzeiler, mal als Miniaturen und dann wieder als lange, geduldige Alltagserkundungen daher. Was sie vereint ist das Groteske, das in ihnen ruht.
Davis gehört zu den großen Erzählern der amerikanischen Literatur, sie hat ein hohes Gespür für Sprache und ihre Wirkung. Der Titel dieser Erzählungssammlung speist sich aus einer Geschichte, die das Gegenteil behauptet und davon erzählt, dass Davis ein Literaturpreis wegen Faulheit vorenthalten wird. Der Vorwurf begründet sich unter anderem auf die These, dass sie zu viele Schmelzworte verwende. »So schriebe ich zum Beispiel die Wörter kann es nicht und will es nicht aus, sondern zöge sie zusammen zu kanns nicht und wills nicht.« Macht nichts, denkt man lesend, man hält den Beweis dafür in den Händen.
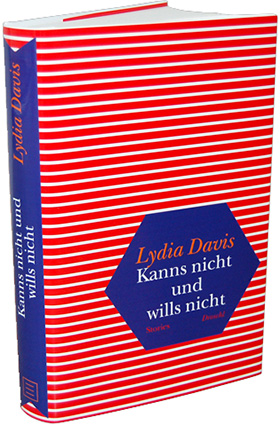
Davis hat ihre Sensibilität für die Wirkung des Geäußerten – für das, was anderen über die Lippen oder aus den Fingern strömt – jahrelang als Übersetzerin der großen französischen Autoren geschult. Dank ihr entdeckten die US-amerikanischen Leser Flauberts Madame Bovary und Prousts Die Suche nach der verlorenen Zeit für sich. Dieser Empfindsamkeit verdanken wir eines der schönsten und bewegendsten Bilder in dieser Sammlung, die in der Erzählung »Die Seehunde« versteckt ist. Die Autorin erinnert sich an ihre verstorbenen Eltern und Geschwister, an die verpassten Möglichkeiten und unnötigen Auseinandersetzungen. Sie weiß, dass sie den Lauf der Dinge nicht mehr ändern kann, aber der Schmerz der Einsamkeit ist groß: »… dich bloß eine Zeit lang als Person hier zu haben, die die Matratze eindrückt und Falten in den Überwurf macht, während die Sinne von hinten auf dich fällt, das wäre wunderbar.« Was will man von Literatur mehr als solche Sätze?
Ein immer wiederkehrendes Motiv ist das des Briefes. Da ist das Schreiben an den Tiefkühlerbsenproduzenten mit der Bitte, das unappetitliche Foto auf der Verpackung des Lieblingsgemüses durch ein passenderes zu ersetzen, der Brief an eine Erzeugerfirma von Pfefferminzbohnen, weil die auf der Verpackung angegebene Menge an Dragees nicht dem Inhalt entspricht oder die Nachricht an einen Hotelmanager, dass der Aufenthalt in seinem Haus ganz wunderbar gewesen, aber in der Hotelbroschüre ein Rechtschreibfehler enthalten sei, die uns, wie auch schon der eingangs erwähnte Brief an die Stiftung, mit den irrwitzigen und verrücken Gedanken ihrer nicht unwesentlich verschrobenen Autoren konfrontieren.
Davis hat in ihre neuesten Erzählungen auch ihre Beschäftigung mit Flaubert einfließen lassen. In Briefen von Flaubert ist sie auf kleine Geschichten gestoßen, die sie in ihrem Band aufgreift und zu Miniaturen verarbeitet hat. Als Leser dieser Anekdoten begegnet man nicht nur dem genauen Beobachter Gustave Flaubert, sondern man fühlt sich umgehend ins Frankreich des 19. Jahrhunderts versetzt.
Neben diesen Flaubertschen Ausflügen lässt Davis ihre Leser in fantastische Welten reisen. Sie hat eigene Träume sowie die von nahestehenden Menschen verwendet, um kleine Anekdoten der inneren Abgründe und Hoffnungen zu schaffen. So sehr wie diese Petitessen des Unterbewussten unter die Haut gehen, so vertraut sind sie dem Leser. Diese Miniaturen erscheinen dabei wie Blicke in unser Inneres.
Lydia Davis zeigt sich in Kanns nicht und wills nicht als großartige Beobachterin der alltäglichen Absurditäten. Etwa wenn sie die Abgründe aufzeigt, die in den Nachrufen stecken, die sie in Lokalzeitungen entdeckt hat. Es braucht keine näheren Erklärungen, um die menschlichen Tragödien dahinter sichtbar zu machen, es reicht, wenn sie unsere Aufmerksamkeit auf die von ihr gesammelten Auszüge lenkt: »Alfred hatte Freude an seinen besten Freunden, das heißt an seinen beiden Katzen.« Es sind aber auch die allgegenwärtigen Wirrnisse der Zeit, die wir in diesen Erzählungen wiederfinden. Etwa wenn sie den Nonsens der computergenerierten Kundenhotlines dieser Welt mit Sätzen wie »Das Problem, das Sie unlängst gemeldet haben, funktioniert jetzt tadellos.« auf den Punkt bringt oder den unzähligen, schlecht übersetzten Spam-Mails, die uns zur Kontaktaufnahme mit wildfremden Menschen auffordern, das gigantische Ausmaß der Einsamkeit der Moderne entnimmt: »Ich schicke dir diese Mail | mit schweren Tränen in den Augen | und großer Sorge in meinem Herz. | Besuche meine Site.«
Was Davis’ neuer Sammlung jedoch fehlt, ist Konstanz. Es besitzen bei weitem nicht alle der hier versammelten Erzählungen eine solche Tiefe. Insbesondere einige der kurzen Stücke bleiben bruchstückhaft und alltäglich, so dass sie sich bestenfalls wie Alltagsnotizen lesen. Es sind die grauen Erbsen auf dieser Packung literarischen Lieblingsgemüses, die den Genuss trüben.
Dennoch hat man es bei der Autorin mit einer schreibenden Detektivin zu tun, die in ihren Geschichten die Komik und Tragik des Alltags einfängt wie es nur wenige vermögen. Wer erfahren will, was Sprache ermöglicht, muss Lydia Davis lesen.


[…] Autorin, die seit den 1970er Jahren immer wieder neu von sich reden macht. Gemeinsam mit fünf anderen Bänden liegen mit diesem Buch nun endlich sämtliche Erzählungen der großen Amerikanerin […]
[…] Total normale Absurditäten […]
[…] Die Einflüsse und Referenzen reichen von den religiösen Urtexten über Homer, Dante Alighieri, Gustave Flaubert, Jonathan Swift, Walt Whitman, James Joyce, Jorge Luis Borges und Cixin Liu. Ein Dämon, der von […]