Der ungarische Autor László Krasznahorkai erhält den Literaturnobelpreis 2025. Keiner habe die Welt so beschrieben wie der Ungar, schwärmt sein deutscher Verleger Oliver Vogel. In seinem Werk blickt er immer wieder in die gesellschaftlichen Abgründe, wo Hass und Gewalt toben. Susan Sontag nannte ihn deshalb einmal den »Meister der Apokalypse«.
»Für sein fesselndes und visionäres Werk, das inmitten apokalyptischen Schreckens die Kraft der Kunst bekräftigt«, erhält der ungarische Autor László Krasznahorkai den Nobelpreis für Literatur 2025. Damit ist er nach der Auszeichnung von Imre Kertész 2002 der zweite ungarische Schriftsteller, dessen Arbeiten mit dem wichtigsten Literaturpreis der Welt geehrt wird. Sein Werk, begründete der ständige Sekretär Mats Malm in Stockholm weiter, stehe in der durch Absurdismus und groteske Übertreibungen gekennzeichneten mitteleuropäischen Tradition, die sich von Franz Kafka bis Thomas Bernard erstrecke. Zudem schlage der 1954 im ungarischen Gyula geborene Schriftsteller einen kontemplativeren, fein abgestimmten Ton an.
Ob dem in Triest lebenden Autor der vom Nobel-Komitee gezogene Vergleich so gefällt, bleibt abzuwarten. Gegenüber der New York Times erklärte Krasznahorkai vor Jahren, dass er als Autor immer versucht habe, einen eigenen, »absolut originellen« Stil zu entwickeln. »Ich wollte frei sein, mich weit von meinen literarischen Vorfahren zu entfernen und keine neue Version von Kafka, Dostojewski oder Faulkner zu schaffen.« Dabei soll er auch bei seinem Landsmann Miklós Szentkuthy Inspiration gesucht haben.
Der schwedischer Autor und Kritiker Steve Sem-Sandberg, der als Mitglied des Komitees den Preis an Krasznahorkai vergeben hat, lobte bei der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Nobelpreises den »kraftvollen, musikalisch inspirierten epischen Stil« des Ungarn. »Es ist Krasznahorkais künstlerischer Blick, der völlig frei von Illusionen ist und die Fragilität der sozialen Ordnung durchschaut, kombiniert mit seinem unerschütterlichen Glauben an die Kraft der Kunst, der die Akademie dazu motiviert hat, den Preis zu vergeben«, fügte Sem-Sandberg hinzu. Unerschütterlich ist Krasznahorkai auch in seiner politischen Haltung, der sowohl Ungarns Regierungschef Victor Orban, als auch die sozialen Verhältnisse inseiner Heimat immer wieder kritisiert hatte.
Das im deutschsprachigen Raum bei S. Fischer verlegte Werk des Ungarn umfasst sieben Romane und drei Erzählbände. Während die bis zur Jahrtausendwende erschienenen Romane »Satanstango«, »Melancholie des Widerstands«, »Der Gefangene von Urga« und »Krieg und Krieg« in der Übersetzung von Hans Skirecki erschienen sind, wurden die Erzählungsbände und Romane seither von Heike Flemming (»Seiobo auf Erden«, »Die Welt voran«, »Herrscht 07769«, »Im Wahn der anderen«) und Christina Viragh (»Im Norden ein Berg, im Süden ein See, im Westen Wege, im Osten ein Fluß«, »Baron Wenckheims Rückkehr«) übersetzt.
László Krasznahorkai in der Übersetzung von Hans Skirecki




Zuletzt erschien der Erzählband »Im Wahn der Anderen«, der drei Erzählungen versammelt, in denen er das Un(be)greifbare erkundet. In einer Erzählung wandelt ein Bibliothekar auf den Spuren Herman Melvilles durch New York und verliert sich dabei selbst. In einer anderen Erzählung erhebt ein seltsames ich die Stimme, ob es sich dabei um den inneren Schweinehund oder den Höllenhund handelt, ist nicht ganz klar. Was wir aber wissen ist, dass uns dieses Wesen nichts Gutes will. »Ich bin das, was ausbrechen wird«, heißt es da in der Übersetzung von Heike Flemming. »Es gibt also kein Entkommen, wenn ich springe, um dir die Kehle durchzubeißen…«
Diese Bedrohung zieht in seinem letzten Roman »Herrscht 07769« in Form einer faschistischen Putzkolonne durch Thüringen. Dieser in einem 400 Seiten langen Satz geschriebene Provinzroman taucht nicht nur tief in die Reichsbürgerszene ein, sondern schafft über die Musik von Johann Sebastian Bach und die durch den Thüringer Wald ziehenden Wölfe eine Weltuntergangsstimmung, wie sie aktueller kaum sein könnte.
László Krasznahorkai in der Übersetzung von Heike Flemming




Sein postmoderner Debütroman »Satanstango«, der an der Schrittfolge eines Tangos entlanggeschrieben ist, spielt in einem heruntergekommenen ungarischen Dorf, dessen Bewohner fast vollständig von der Außenwelt isoliert sind. Die Hauptfigur, Irimiás, ein Betrüger, der sich als Retter ausgibt, erlangt fast unbegrenzte Macht über die Bewohner und nutzt seine Macht zur Manipulation. Die Erzählung stützt sich auf biblische Elemente, setzt auf apokalyptische Szenen und außerweltliche Zeitverhältnisse. Die Verfilmung durch den ungarischen Regisseur Béla Tarr, der später auch Krasznahorkais zweiten Roman »Melancholie des Widerstands« adaptiert hat, ist mit 450 Minuten einer der längsten jemals gedrehten Filme und genießt unter Cineasten Kultstatus.
László Krasznahorkai wurde seit Jahren neben seinem zwölf Jahre älteren Landsmann Péter Nádas als einer der heißesten Anwärter auf den Nobelpreis gehandelt. 2015 erhielt er für sein Gesamtwerk den International Booker Prize, 2021 den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. Der damalige Laudator und heutige Leiter des Grazer Literaturhauses Klaus Kastberger prophezeite vor wenigen Tagen, dass Krasznahorkai den diesjährigen Literaturnobelpreis bekommen werde. Entsprechend flink war er am Tag der Bekanntgabe mit seinem Statement. Er lobte Krasznahorkai als »Großmeister literarischer Intensität«, als »Seher und Visionär«, der »autonome und zwingende ästhetische Räume« wie mit Zauberhand herstelle. Zudem sei sein Gestus als Dichter einzigartig.
László Krasznahorkai in der Übersetzung von Christina Viragh


Weiter schrieb Kastberger auf Facebook: »In souveränen und komplex verflochtenen Sätzen beschreibt er in seinen Romanen heruntergekommene Wirklichkeiten, enttäuschte Hoffnungen und die Gewalt gesellschaftlicher Zusammenhänge. Er entwirft verstörende Panoramen der ungarischen Kleinstadt, begibt sich zwischen Japan und New York auf Expeditionen in weit entfernte Weltgegenden, erkundet die ostdeutsche Wirklichkeit nach dem Mauerfall in provokativen Zusammenhängen und kehrt doch immer wieder zu den Ausgangspunkten seines Schreibens zurück. Seine Bücher sind heute in Ungarn teilweise im Schulunterricht verboten, aber Krasznahorkai ist und bleibt ein europäischer Autor von Weltgeltung: Gewaltige Visionen einer anderen Welt durchziehen seine Bücher, Heilsversprechen bauen sich auf und stürzen in sich zusammen. In der ganzen Melancholie seines Werkes nistet immer Humor. So, als würde es sich gerade dabei um das eigentliche Agens eines freieren und besseren Lebens handeln.«
Krasznahorkais deutscher Verleger Oliver Vogel erklärte gegenüber dem Börsenblatt, dass der Ungar die Welt schon lange so beschrieben habe, wie sie vielen vermutlich gerade erscheine. »Er erzählt, was fehlt. Er erzählt, was fehlt, an Menschlichkeit, an Trost, an Glauben an das Heilende, auch in der Kunst. All das ist verlorengegangen im letzten Jahrhundert, und dieses Fehlen bemerken wir in unserer Gegenwart vielleicht so schmerzhaft, wie schon lange nicht mehr. Und gerade das, dass wir es merken, ist vielleicht der Trost, die leise Hoffnung, die uns bleibt – die jedenfalls das große Werk dieses großen Schriftstellers vorantreibt. Ein Werk, das von seiner Konsequenz getragen wird und von einer leidenschaftlichen Sorge.«
Vogel kündigte an, dass der Verlag bereits den Nachdruck aller Titel von Krasznahorkai beauftragt habe. Wie schnell die lieferbar sind, bleibt angesichts der aktuellen Krise in der Druckindustrie fraglich. Wie die Frankfurter Buchmesse inzwischen mitteilte, wird der Ungar bei der Eröffnungspressekonferenz sprechen.
Krasznahorkai war 1987/88 im Rahmen des DAAD-Künstlerprogramms in Berlin. Silvia Fehrmann, Leiterin des Programms, betont: »Der Residenzaufenthalt 1987/88 war der Beginn einer bleibenden Verbindung zu Berlin. Hier hat Krasznahorkai gelebt, geschrieben und als Samuel-Fischer-Gastprofessor an der Freien Universität Berlin unterrichtet.«
László Krasznahorkai folgt der südkoreanischen Autorin Han Kang, dem Norweger Jon Fosse, der Französin Annie Ernaux, dem britisch-tansanischen Schriftsteller Abdulrazak Gurnah und der amerikanischen Lyrikerin Louise Glück. Der Nobelpreis wird am 10. Dezember in Stockholm übergeben, das Preisgeld beträgt circa eine Million Euro.

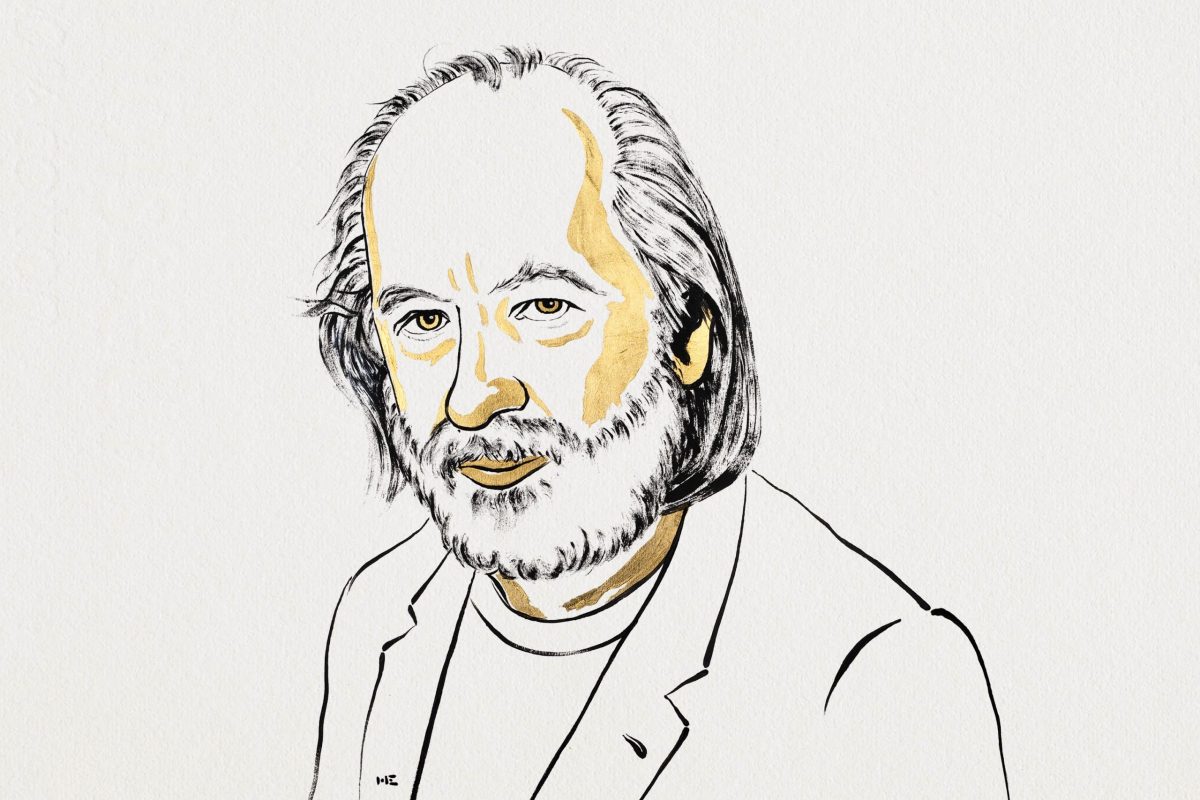
[…] mit 50.000 £ dotierte Preis erstmals an einen ungarischstämmigen Autoren. Nach der Vergabe des Literaturnobelpreises an den Ungarn László Krasznahorkai vor wenigen Wochen durchaus bemerkenswert. Literaten aus Ungarn beziehungsweise mit ungarischen […]