Am 15. Oktober 2025 wurde mir auf der Frankfurter Buchmesse die Übersetzerbarke des VdÜ, Verband deutschsprachiger Übersetzer/innen literarischer und wissenschaftlicher Werke e.V. verliehen. An dieser Stelle dokumentiere ich meine Dankesrede, in der ich über die Motive meines Engagements für die literarische Übersetzung spreche. Und darüber, warum wir mit Übersetzungen einen Wald betreten, aber das Meer finden.
Liebe Marieke, Liebe Bettina, Liebe Karin, Liebe Freunde und Gäste, vielen Dank für diese Auszeichnung, die mich wirklich unheimlich ehrt.
Mein literarisches Engagement hat offen gestanden recht spät begonnen. Bis zu meinem Abitur habe ich kaum gelesen, aber wenn, dann Literatur, die übersetzt war. Die ersten Bücher, die ich als bewusste Lektüre in Erinnerung habe, sind Alexander Wolkows sowjetische Nachdichtungen des »Zauberers von Oz« in der Übersetzung von Lazar Steinmetz. In der DDR kam dieser Zauberer aus der Smaragdenstadt und als vielleicht Zehnjähriger las ich mich begeistert durch diese Welt. Dann erinnere ich mich noch an eine Jostein-Gaarder-Phase als Teenager. Dessen Romane muss Gabriele Haefs in ein so einnehmendes Deutsch gebracht haben, dass sie mir trotz der alterstypischen Selbstfindungsstörungen in Erinnerung geblieben sind.
Keine Sorge, ich referiere Ihnen jetzt nicht meine Lesebiografie. Dass ich heute Kritiker bin, ist neben einer spät entdeckten Leseleidenschaft – gepaart mit einem ganz offensichtlichen Mitteilungsbedürfnis – auch ein paar Menschen zu verdanken, die mich auf dem Weg hierher begleitet und unterstützt haben.
Anfangs war das vor allem meine langjährige Lebensgefährtin Rahel, die meinem zwanzigjährigen Ich einige längst überfällige Lektüren nahegelegt hat. Inzwischen sind das vor allem meine ebenso liebe- wie verständnisvolle Partnerin Sabrina sowie mein aufgewecktes Bonuskind Wilma, die es mir das ein ums andere mal nicht krumm nehmen, wenn ich ihre Einladungen ins Kino oder zum Spazieren zerknirscht mit dem Satz ablehne: »Ich muss eigentlich noch etwas lesen / schreiben.« Oder mein wunderbar geerdeter und nicht ganz so leseaffiner Sohn Oskar, von dem ich mich immer wieder herausgefordert fühle, ihm zu erklären, warum er dieses oder jenes Buch nun doch wirklich mal lesen müsse. Und meine langjährigen Wegbegleiterinnen Antje und Sabine, die mich nie unkritisch, aber immer wohlwollend zum Schreiben ermuntern.
Seit ich denken kann ist aber auch ein Mensch an meiner Seite, der im Literaturbetrieb gern mal für meine Schwester oder Ehefrau gehalten wird: meine Cousine Maria Hummitzsch. Als sorgfältige Übersetzerin und engagierte Lobbyistin für ihre Kunst und ihre Kolleg:innen hat sie mich mit ihrem ganz eigenen Charme für die literarische Übersetzung eingenommen.
Als ich in den Nuller Jahren begann, Bücher zu rezensieren, unterlief mir irgendwann ein folgenreicher Fehler: Ich vergaß bei einer Besprechung die Übersetzerin oder den Übersetzer zu nennen. Ich weiß weder, um welches Buch es damals ging, noch erinnere ich den genauen Wortlaut ihrer E-Mail. Aber im Kern stand da so etwas wie: »Ey Alter, der Roman wurde von jemandem übersetzt, also schreib das da gefälligst auch hin.«
Dieser flapsig-liebevolle Kommentar war nicht nur ein Ordnungsgong zur rechten Zeit, sondern auch der Anfang eines bis heute andauernden Dialogs über das literarische Übersetzen, von dem ich keinen Moment missen möchte. Dass dieser Dialog längst zu einem vielstimmigen Gespräch mit vielen anderen Übersetzenden geworden ist, hat auch mit Maria und ihrem Vernetzungstalent zu tun. Wenn also irgendjemand so richtig dazu beigetragen hat, dass ich heute die Übersetzerbarke entgegennehme, dann Du, liebe Maria. Vielen Dank für alles, für Deine Eys und Heys, für Ordnungsrufe und Denkanstöße, für Anerkennung, Motivation und Ermutigung – auch in schwierigen Zeiten. Hätten all meine Kolleg:innen jemanden wie Dich an ihrer Seite, sähe es um die Übersetzungskritik hierzulande anders aus.
Ich möchte mich nicht zuletzt aber auch bei Ihnen, den Übersetzerinnen und Übersetzern, für die Sisyphosarbeit bedanken. Letztlich sonne ich mich im Licht Ihrer Arbeit, die mir immer wieder den Blick auf neue Welten eröffnet und meinen Horizont erweitert. Der Preis gehört Ihnen, den Übersetzerinnen und Übersetzern, mindestens genauso wie mir.
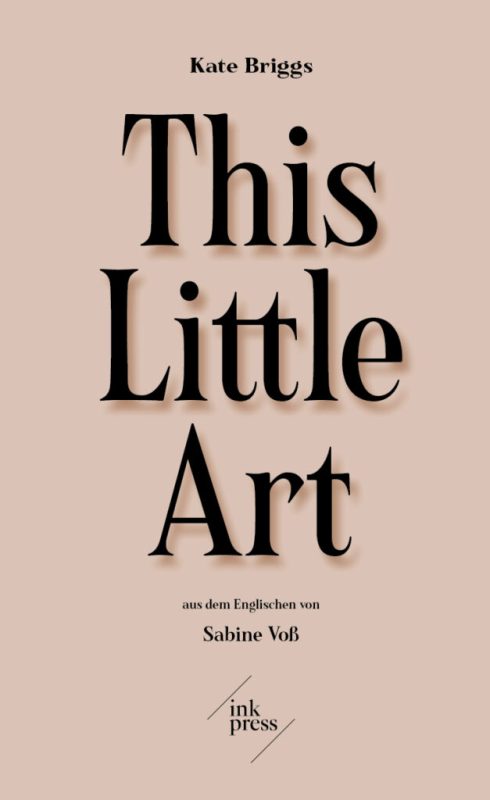
Die Schriftstellerin und Übersetzerin Kate Briggs berichtet in »This Little Art«, ihrem genreübergreifenden Loblied auf die Praxis des literarischen Übersetzens, von einem Heureka-Moment in der Pariser Nationalbibliothek. Beim Anblick der Stauden im Bibliothekswald, so liest man in Sabine Voß‘ Übersetzung, sei ihr bewusst geworden, dass die Pflänzlinge in Wirklichkeit einmal die Blüten in den Kronen von Bäumen waren, die aus einem weit entfernten Wald stammen. In Paris nun gründen diese einstigen Blüten in einem neuen Umfeld einen zweiten, etwas anderen Wald.
Mir gefällt dieses Bild der zwei Wälder, der eine hier, der andere dort, beide in der Tiefe verbunden und doch ist jeder für sich ein eigenständiger Organismus. Das spiegelt in meinen Augen gut das Verhältnis von Original und Übersetzung, die urheberrechtlich, sprachlich und künstlerisch jeweils eigenständige Werke darstellen, in der Tiefe aber miteinander verbunden sind.
Ich nutze das Bild der zwei Wälder auch in meinem jüngsten Essay, in dem ich über den Zu- oder besser gesagt Missstand der Übersetzungskritik nachdenke. Denn es veranschaulicht in meinen Augen auch etwas anderes: nämlich dass einige meiner Kolleg:innen beim Blick auf übersetzte Literatur ganz offenbar den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.
Etwa wenn Der Spiegel die 100 wichtigsten internationalen Romane seit 1925 präsentiert und dabei nicht eine Übersetzerin oder einen Übersetzer nennt. Oder wenn im aktuellen Buchmesse-Spezial der Literarischen Welt in keiner einzigen Besprechung eines übersetzten Buchs die Tatsache seiner Übertragung überhaupt Erwähnung findet. Oder wenn auf den zwei Dutzend Messeseiten von Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung und Süddeutscher Zeitung es jeweils nur eine Kritikerin schafft, die Übersetzung des gelesenen Romans – ganz am Rande wohlgemerkt – einfließen zu lassen.
So anekdotisch dies wirkt, so sehr regt es mich auf. Weil es eben nicht anekdotisch, sondern symptomatisch ist. Symptomatisch für eine Literaturkritik, die sich aus der Analyse zunehmend in die unterhaltende Nacherzählung zurückzieht. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass in Rezensionen die Sprache eines übersetzten Romans ausgiebig gelobt wird, ohne zu erwähnen, dass diese Sprache von Übersetzenden gestaltet ist? Dass lange Zitate weder den Figuren noch den Übersetzer:innen in den Mund gelegt werden, sondern, Sie ahnen es vermutlich, den Autor:innen des Originals?
Das sind Dinge, die verstehe ich einfach nicht. Denn in diesen Fällen hat nicht eine handelnde Person einen schlechten Moment gehabt – und ja, den haben wir alle mal –, sondern eine ganze Redaktion ihr Handwerk vergessen.
Das Vertrackte an einer guten Übersetzung ist, dass sie alles tut, um ihre eigene Existenz vor den Augen der Lesenden zu verbergen. Dass sie sich unsichtbar macht, um als Original missverstanden zu werden. Eine gute Übersetzung ist in meinen Augen wie ein guter Zaubertrick: je unauffälliger sie daherkommt, desto gelungener ist sie.
Und ja, Kinderaugen dürfen dann leuchten, und ja, auch Erwachsene, selbst Kritiker:innen dürfen sich von diesem Zauber einnehmen lassen. Aber doch bitte nicht blindäugig, denn dieser Zauber erfolgt mit Ansage. Er ist Teil einer stillschweigenden Vereinbarung, die alle in der Buchbranche kennen sollten. Literaturkritiker:innen sollten wissen, dass es aus jeder übersetzten Zeile schreit: »Ich bin eine Übersetzung.« Frei nach dem Motto: Schau her und entdecke, wie ich mich vor dir verstecke.
Mir persönlich ist dieses Entdecken wichtig, es macht einen großen Teil meines Lesevergnügens aus. Die Geschichte ist das eine, ihre stilistische Gestalt und sprachliche Ausformung das andere. Das eine wirkt auf das andere und umgekehrt.
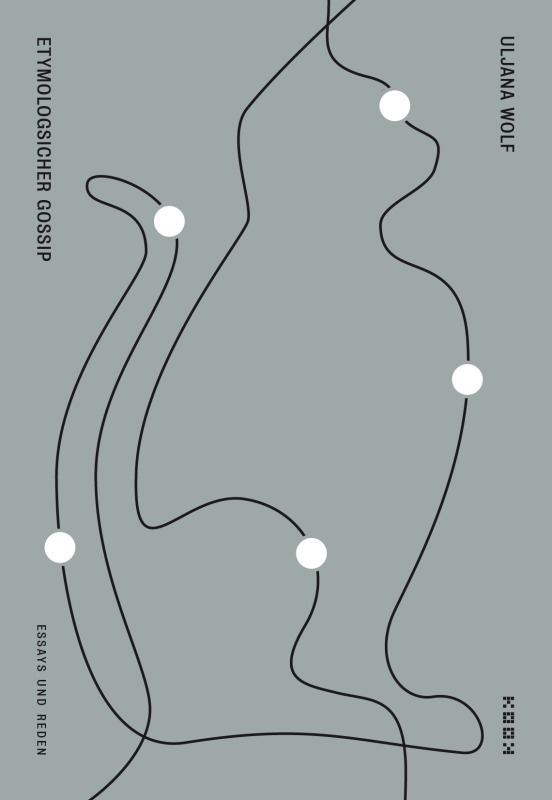
Die Lyrikerin und Übersetzerin Uljana Wolf denkt in »Etymologischer Gossip« viel über das Verhältnis von Original und Übersetzung nach. An einer Stelle erinnert sie an ihre amerikanische Kollegin Mary Ruefle, die mit dem Tipp-Ex nachträglich Wörter aus ihren Texten entfernt hat. Ruefle bezeichnete die weißen Flecken auf der Seite als kleine weiße Schatten – als »Little White Shadows«. Uljana Wolf fragt dann folgerichtig, was hier eigentlich genau Schatten wirft: Die Buchstaben, die stehen bleiben, oder die, deren einstige Existenz unter dem Tipp-Ex unsichtbar durchschimmert. Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem.
Eine Übersetzung kann dieses Spiel mit Licht und Schatten aus dem Original nicht eins zu eins nachbilden. Aber sie kann mit den gleichen Mitteln, mit bedeutungstragenden Einheiten und funktionalen Lücken, ein Leuchten hervorbringen. Ein Leuchten, das der originären Belichtung des literarischen Stoffes so nah wie möglich kommt. Wie im Original geben Licht und Schatten dem übersetzten Text seinen Rhythmus, trennen Reden vom Schweigen, lassen die Lesenden ein- und wieder ausatmen. Zugleich bilden Wortschatz und Syntax eine Melodie, aus der heraus sich ein Körper erhebt, der lebt und tanzt.
Wenn ein Autor entscheidet, wie er die Wirklichkeit in Sprache überführt, dann entscheiden Sie als Übersetzerinnen und Übersetzer, in welche Sprache, welchen Duktus sie die gemeinte Wirklichkeit zurückübersetzen. Es gehört zu meinem Handwerk, diesen Transfer ausfindig zu machen, die Leistung dahinter zu identifizieren und das, um es mit Marias Worten zu sagen, da gefälligst auch hinzuschreiben.
Manchmal ist das offensichtlich, gerade bei sprachlich auffälligen Werken wie Joshua Cohens »Witz« oder Raymond Queneaus »Stilübungen«. Hier liegen die übersetzerischen Leistungen auf der Hand. Wer sie nicht sieht, ist blind, wer sie als Kritiker:in nicht benennt, versteht entweder sein Handwerk nicht oder ist schlicht bösartig ignorant.
Heike Geißler beschreibt in ihrem Essay »Verzweiflungen« ganz treffend die Tätigkeit von Übersetzenden. Sie schreibt: »Ich übersetze alle große Gegenwart in unsere kleine Gegenwart.« Ein simples Beispiel für diesen Transfer aus der großen in die kleine Gegenwart findet man in Uljana Wolfs »Gossip«-Band: Führt man im Englischen jemanden in die Irre, heißt es dort, schickt man ihn nicht auf den Holz-, sondern begleitet ihn auf dem Gartenweg: »lead someone down the garden path.«
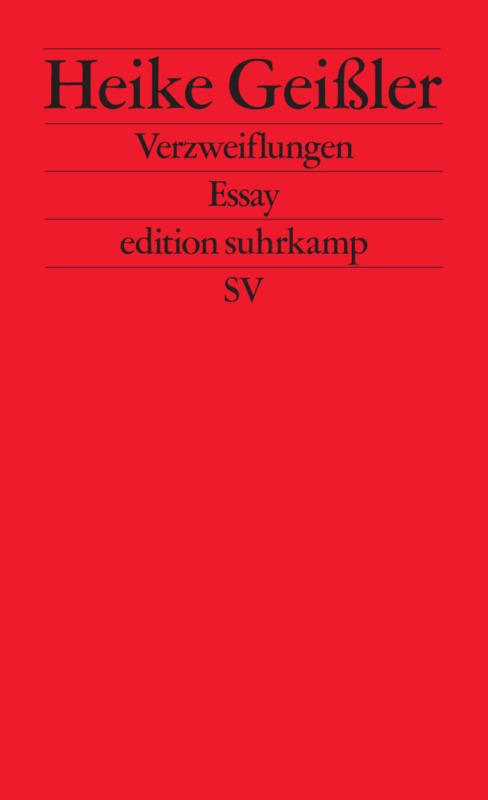
Die Auflösung solcher Transfers ist aber nicht immer so offensichtlich wie in diesem Beispiel. Meist liegt der Teufel im Detail. Die »little Art«, von der Briggs spricht, und die »little shadows«, die Ruefle anführt, zielen genau auf dieses Detail. Briggs und Ruefle machen das literarische Übersetzen nicht zu einer Kleinigkeit, sondern weisen auf die filigrane Textarbeit des Übersetzens hin. Oder um es salopp zu sagen: Übersetzende bewegen Welten, indem sie an den kleinen Stellschrauben drehen, um den großen Unterschied zu machen. Werden diese Stellschrauben nicht erkannt, werden Werke oft als – Sie werden diese Adjektive kennen – elegant, flüssig und tadellos zu lesen beschrieben.
In der besten aller Welten griffe in Momenten, in denen sich bei Kritiker:innen diese Empfindung einstellt, ein Reflex. Ein Reflex, die Übersetzenden zu kontaktieren und nachzufragen, wie sie entstanden ist, diese flüssige Lektüre. Schon klar, nicht immer hat man die Zeit, aber ich befinde mich ja gerade in der besten aller Welten. Ich persönlich bin bislang immer klüger aus einem Gespräch mit Übersetzenden herausgegangen als hinein; niemand kennt einen Text so gut wie die Urheber:innen, also die, die ihn verfasst haben – und ja, das sind im Falle einer Übersetzung nun mal die Übersetzenden. Wer meint, Übersetzerinnen und Übersetzer hätten nichts zum Textverständnis beizutragen, hat nur Angst davor, die Grenzen der eigenen Lesart aufgezeigt zu bekommen.
Dabei wäre das keine Schande. Die übersetzerische Liebe zum Detail erfordert oft stundenlanges Kopfzerbrechen, um wie Thomas Weiler in »Europas Hunde« Neologismen wie »Holgerdiepolger« im eigenen Wortschatz freizulegen oder um wie Timea Tankó in »Apropos Casanova« eine »Optimismusbordüre« an die andere zu kleben. Oder um den Rhythmus des Mittelmeers in die Syntax zu übertragen, wie es Moshe Kahn in seiner Übersetzung von Stefano D’Arrigos Sizilien-Epos »Horcynus Orca« tut:
»Das Boot glitt hinauf zu den Meeren von Skylla und Charybdis, unter den zerrissenen Seufzern und Klagen der Jungs, wie in einem Meer von Tränen, das mit jedem Ruderschlag entstand und wieder verging, drinnen, tief drinnen, dort, wo das Meer ist, das Meer.«
Aus »Horcynus Orca« von Stefano d’Arrigo in der Übersetzung von Moshe Kahn
Unverhofft sind wir aus dem Wald getreten und blicken aufs Meer. Es ist auch Zeit, schließlich braucht eine Barke Wasser unterm Kiel. Maria hatte mir empfohlen, auch darüber zu sprechen, warum mir das literarische Übersetzen und jene, die es betreiben, so wichtig sind. Ich war kurz verwundert. Ist es nicht meine Aufgabe als Literaturkritiker, sich mit dem zu befassen, was Literatur ausmacht? Mit der Sprache und dem, was sie in uns auszulösen vermag? Ich meine schon. Und diese Sprache gehört in Fällen übersetzter Literatur nun mal Ihnen, den Übersetzenden.
Aber ich will mich ehrlich machen: Auch ich finde nicht immer die perfekten Worte, um zu beschreiben, wie es Ihnen gelingt, mich aus dem künstlichen Zweitwald in den ursprünglichen Dschungel und von dort ans Meer zu bringen. Manchmal fällt mir erst Tage später ein, wie ich Dinge besser hätte zeigen, erklären, sagen müssen. Und ja, natürlich ärgert es mich, wenn es dann schon zu spät, der Text schon gedruckt ist. An guten Tagen fällt mir dann Beckett ein: »Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.«
Fail better: das möchte ich angesichts des lamentablen Zustands der Übersetzungskritik hierzulande auch gern meinen Kolleg:innen zurufen. Habt keine Angst vorm Scheitern, die Latte liegt immer so hoch, wie man zu springen vermag. Mit jedem Sprung steigt das Niveau. Deshalb finde ich auch jeden gut gemeinten Anlauf besser, als die Hybris, es wissend erst gar nicht zu versuchen.
Ein anderer Grund für mein Engagement für Übersetzende scheint mir ein emotionaler zu sein. Als Literaturkritiker müsste ich mich nicht zwingend mit den Arbeitsbedingungen und Kräfteverhältnissen im Löwenkäfig des Literaturbetriebs beschäftigen? Aber mein Herz schlägt in dieser Welt einfach für jene, die nicht nur den simplen Gesetzen des Erfolgs und des Geldes folgen. Das sind im Literaturbetrieb neben vielen kleinen und unabhängigen Verlagen eben oft die Übersetzenden. Nicht wenige von Ihnen gehen unter oft schwierigen Bedingungen stoisch ihrer Berufung nach.
Ich kenne das selbst, meine Miete verdiene ich nicht mit launigen Buchbesprechungen. Aufwand und Ertrag stehen in der Literaturkritik in keinem gesunden Verhältnis, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe für den Moment meinen Frieden damit gemacht. Aber ich beobachte mit Sorge, dass es immer mehr Übersetzende in andere Tätigkeitsbereiche zieht. Die prekäre Situation der Kreativen ist ein grundsätzliches und branchenübergreifendes Problem.
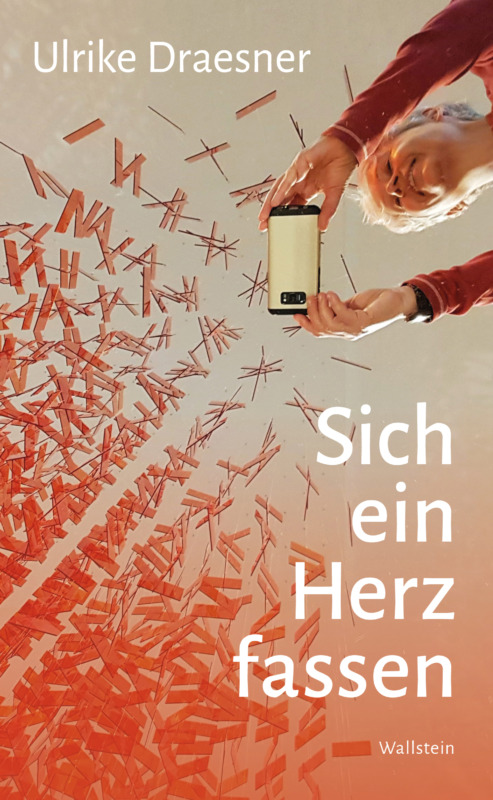
Ulrike Draesner sprach in ihrer Göttinger Poetikvorlesung über die Zukunft der Kreativität. Unter dem Schlagwort life writing machte sie sich stark für eine Literatur, »geschrieben mit einem Körper, warm durchblutet, sterblich… sternlich… stimmlich…: der erlebt und gelernt hat…, der Welten, Begegnungen, Zeiten und Räume durch sich hindurch erfährt und verwandelt«. Einer solchen Literatur gehöre die Zukunft, so Draesner.
Wenn dem so ist, möchte ich mich analog für life translating aussprechen. Denn in vom Leben getragenen Übersetzungen steckt die Erfahrung echter Menschen. Diese Menschen wahrzunehmen, ihre Entscheidungen und Strategien zu erkennen und zu verstehen, zu beschreiben und zu interpretieren, ist in meinen Augen die ureigene Aufgabe der Literaturkritik, wie ich sie mir und Ihnen allen wünsche.
Sie sehen, wir brauchen Ihre Übersetzungen. Wir brauchen Übersetzungen, die atmen, die empathisch und gefühlvoll sind. Übersetzungen, bei denen Intellekt, Instinkt und Intuition die Feder führen, und nicht eine kühl kalkulierte Wahrscheinlichkeit. Denn nur derart mit Leben gefüllte Texte machen es möglich, dass wir beim Lesen in ferne Zeiten und fremde Welten fallen, in anderen Kulturen versinken oder uns in den Erfahrungen der Figuren wiederfinden. Sie prägen sich uns ein und lassen uns anders werden.
Und, wie Karin Uttendörfer und Tim Trzaskalik im Toledo-Journal zu ihrer famosen Übersetzung von Davi Kopenawas Vermächtnis »Der Sturz des Himmels« schreiben: »Je mehr wir anders / zu Anderen werden, desto besser lesen, desto besser verstehen wir.« Desto besser verstehen wir: wer wir sind und wer wir sein wollen. Und vielleicht auch, wie es sein kann, dass wir einen Wald gegangen sind, aber das Meer gefunden haben.
Vielen Dank.

