Der französische Shootingstar Édouard Louis schrieb erst über die Flucht aus den Verhältnissen von Gewalt und Armut. Inzwischen erkennt er die tiefergehenden Folgen dieser Erfahrung bei seinen Eltern. Mit seinen schmalen Elternbänden nähert er sich nicht nur seinen Eltern an, sondern legt die Verachtung der Armen und Chancenlosen in seinem Land schonungslos offen.
Stefan Zweig beschreibt in »Marie Antoinette« die von Hunger und Elend gepeinigten aufständischen Frauen, die 1789 beim Anblick des zum Schafott geführten Königs aus Reflex »Es lebe der König« schreien. Édouard Louis erkennt darin seine Mutter wieder, diese Mischung aus Unterwerfung und Aufruhr, der sie sich selbst jahrelang gefügt und aus der sie sehr spät ausgebrochen ist.
Die Zweig-Anekdote steht in seinem autofiktionalem Debüt »Das Ende von Eddy«, in dem Louis über die Flucht eines empfindsamen Jungen aus dem Prekariat, die Bedeutung von Männlichkeit unter einfachen Leuten und das Coming-Out seines Alter Egos schreibt. Der erschütternde Roman machte 2014 den damals 23-jährigen Franzosen über Nacht zum hellsten Stern am französischen Literaturhimmel. Dazu beigetragen hat sicherlich auch seine enge Verbindung zu Didier Éribon und dessen Lebensgefährten Geoffroy de Lagasnerie. Zu dritt treiben sie mit ihrer gleichermaßen autobiografischen wie gesellschaftskritischen Literatur die linksintellektuellen Diskurse in Frankreich voran.
Seinem Debüt ließ Édouard Louis den beklemmenden Roman »Im Herzen der Gewalt« folgen. Es ist das verstörende Protokoll einer Eskalation, die den inzwischen dreißigjährigen Starautor mit Anfang 20 fast das Leben gekostet hätte. Darin beschreibt er eine Nacht, die er mit einem Unbekannten im Gespräch verbracht hat und der am Morgen danach eine Anzeige wegen versuchtem Mord folgt. Dieser Roman war die radikale Fortschreibung von den Tritten in den Bauch und dem Schmerz, »wenn mein Kopf an die Backsteinwand prallte«, die er in seinem Debüt mit Blick auf seine Erinnerungen an die Schule beschrieb.

»Das Ende von Eddy« beginnt mit dem erschütternden Satz »An meine Kindheit habe ich keine einzige glückliche Erinnerung«, dem dann eine Abrechnung mit dem bildungsfernen Milieu, dem er entstammt, folgt. Christian Baron, der, wenn man das so sagen kann, aus ähnlichen Verhältnissen kommt, hat mit »Ein Mann seiner Klasse« einen ebenso berührenden wie brodelnden Roman geschrieben. Darin beschreibt er in großen Schleifen, was es heißt, in einem reichen Land in Armut aufzuwachsen. Sein Roman ist eine Art Antithese zu Louis Debüt, in dem der Franzose – zumindest hat es Baron so gelesen – kein gutes Haar an seinen Eltern lässt.
Dass er es anders kann, beweist Louis in zwei überaus schmalen Bänden, der eine zählt gerade einmal 70 Seiten, der andere schafft es nicht einmal auf 100. Sie bilden die Flügel zu einem literarischen Triptychon, an dem er seit 2018 schreibt. Damals erschien »Wer hat meinen Vater umgebracht«, ein Essay über das Leiden des alkoholkranken Vaters, der »zu jener Kategorie von Menschen [gehöre], für die die Politik einen verfrühten Tod vorgesehen hat«. Das Mutterporträt ist das Gegenstück dazu, die Geschichte einer Frau, deren Leben »ein Kampf gegen das Leben« gewesen sei, wie er schreibt. Beide Texte sind verbunden durch sein gerade in Frankreich erschienenes Buch »Changer : méthode« (was soviel wie »Veränderung als Prinzip« heißt und voraussichtlich im Herbst 2022 bei Aufbau erscheint), in dem er die Metamorphosen seines Lebens als Überlebensstrategie in den Blick nimmt.
Sowohl im Vater- als auch im Mutterbuch fallen Sätze, die man so oder so ähnlich schon im Debüt gelesen hat. Er müsse sich aber wiederholen, »wenn ich von deinem Leben erzähle, denn von einem solchen Leben will niemand hören«, schreibt er an seinen Vater. »Man muss sich doch wiederholen, bis sie uns zuhören! Um sie zum Zuhören zu zwingen! Wir müssten doch eigentlich schreien!«

Schreien aber ist die Sache des Franzosen nicht, er fügt daher dem Verb noch ein b hinzu und schreibt seinen Eltern hinterher. Dem Vater bis ins Grab, denn er ist vor einigen Jahren an seinem kaputten Körper im wahrsten Sinne des Wortes zugrunde gegangen. »Die Geschichte deines Körpers ist eine Anklage der politischen Geschichte«, heißt es am Ende, nachdem Louis in knappen Sätzen das Leben eines Mannes gezeichnet hat, dessen Körper von den Umständen, die seinesgleichen von der Gesellschaft zugedacht sind, gebrochen wurde. »Dein Leben beweist, das wir nicht sind, was wir tun, sondern im Gegenteil sind, was wir nicht getan haben, weil die Welt oder die Gesellschaft uns daran gehindert hat. Weil etwas über uns gekommen ist, das Didier Éribon Urteile nennt – schwul, trans, Frau, schwarz, arm –, und diese Verdikte bewirken, dass gewisse Lebensentwürfe, gewisse Erfahrungen, gewisse Träume unerreichbar sind.
Das Bild des zerbrochenen Körpers hält Louis – in der formidablen Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel – auch sprachlich. Als sich Louis Mutter von seinem Vater trennt, schreibt der Sohn »Irgendetwas in dir war kaputtgegangen« und das etwas, das über den Vater kam, war nichts konkretes, sondern eine Last, wie man sie auch auf den Schultern tragen könnte. Eribons Vater aber hatte keine Chance, diese Last zu schultern, sie zerschmetterte ihm gleich die ganze Wirbelsäule. War er bis dato nur von der Leistungsgesellschaft abgehängt, fällt er nun ganz aus ihr heraus. Aufgrund seiner Arbeitsunfähigkeit war der Vater fortan auf staatliche Unterstützung angewiesen. Die Kürzungen der Sozialleistungen unter Sarkozy rauben ihm jede Chance auf ein würdevolles Leben.
»Diese Art von Demütigung durch die Herrschenden knickt deinen Rücken noch mehr.« Diesen Satz wiederholt Louis mantra-artig am Ende des Vaterbandes, der so viel versöhnlicher im Umgang mit dem alkoholkranken Mann, der er war, ist, als der Blick in dem wütenden Debüt.

Die Wut zielt hier woanders hin. Auf die Politik, die die Umstände, an denen Menschen wie Édouard Louis Vater zugrunde gehen, nicht nur toleriert, sondern sie befördert. »Für uns«, schreibt Louis, ist diese Politik »eine Frage von Leben und Tod.« Für uns – diese zwei Wörter machen deutlich, dass Louis, nachdem er seine Herkunft so brutal abgeschüttelt hat, sich nun wieder zu ihr bekennt, weil er weiß, dass er jetzt, wo er eine Stimme hat, für die, die doch schreien müssten, aber es nicht tun, schreiben muss.
Dieses Schreiben für die Erniedrigten setzt er in »Die Freiheit einer Frau« fort. In diesem neuen Band geht es um die Kämpfe seiner Mutter. Mit 19 Jahren hat sie bereits zwei Kinder, keine Ausbildung und den falschen Typen an ihrer Seite. Sie lernt Louis Vater kennen, mit dem sie nicht nur ihr drittes Kind bekommt, sondern von einem Elend ins nächste rutscht. Édouard wird nicht ihr letztes Kind sein, trotz Verhütung folgen zwei weitere. In der siebenköpfige Familie – der Vater bringt auch zwei Kinder mit – wird jede:r auf eigene Weise verloren sein. Denn die Bellegueules leben unter Umständen, die keine Wahl lassen, über die eher geschwiegen als geschrieben wird.
Die Literatur selbst sei »gegen solche Leben und solche Körper« wie den der Mutter konstruiert, meint Louis. Über sie und ihr Leben zu schreiben, heiße daher, »gegen die Literatur anzuschreiben.« Angesichts der Texte von Autor:innen wie Annie Ernaux, Nicolas Mathieu, Virginie Despentes und seinen Mentor Didier Éribon scheint das zwar etwas überzogen, aber der Starautor hat nicht ganz unrecht, wenn man die Hochliteratur nach authentischen Zeugnissen der Arbeiterklasse durchsucht. Da findet man allenthalben mehr gut situierte Professorentöchter, Jungautoren, Arztsöhne und Kulturschaffende, die therapiebedürftig durch ihre Wohlstandswelt taumeln, als Arbeiterkinder und Verkäufer:innen, die um ihren Platz in der Welt ringen. Dabei wären deren Kämpfe doch wenigstens wirklich Existenziell, wie etwa J. D. Vance US-amerikanische »Hillbilly Elegie« oder Douglas Stuarts ausgezeichneter Roman »Shuggie Bain«, der im britischen Arbeitermilieu spielt, beweist.
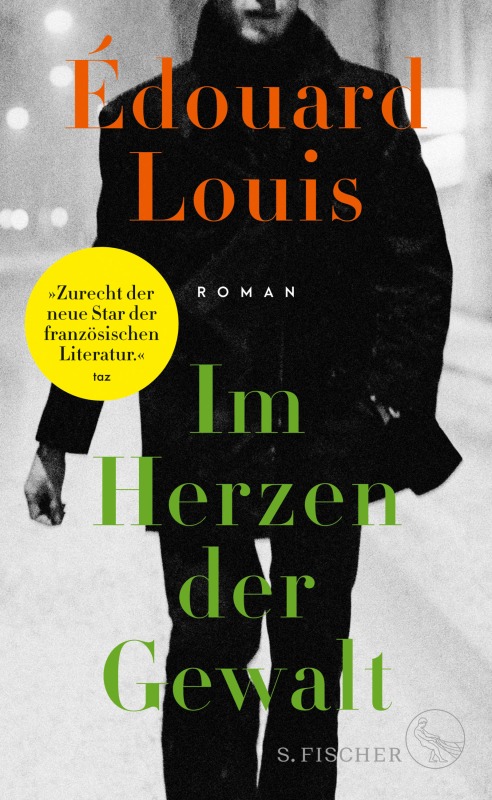
Die Vernachlässigung der einfachen Leute ist Édouard Louis als bekennender Anhänger der linkspopulistischen Gelbwesten-Bewegung sehr bewusst. Dass er sich mit seinen autofiktionalen Texten nicht nur seinen eigenen Schmerz von der Seele schreibt, sondern auch die Zustände in seinem Land schonungslos offenlegt, ist wohl kein Zufall. Die Gewalt, über die er immer wieder spricht, ist fast ebenso eine politische, wie sie eine physische ist. Denn die Schere zwischen Arm und Reich geht auch in Frankreich immer weiter auseinander. Auch die Gewalt, deren Opfer er an einem Weihnachtsabend in Paris geworden ist, hat in der rassistischen Erfahrung, die der Täter als Sohn algerischer Einwanderer gemacht hat, politische Motive. Den dringlichen Ton seiner Literatur muss man also auch ein stückweit als Teil eines politischen Programms lesen. Eines Programms, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, diejenigen hör- und sichtbar zu machen, die die Etablierten weder hören noch sehen wollen.
Dieses Programm überträgt er in eine bildhafte, greifbare Sprache. In Hammerschlägen gleichenden (Ab)Sätzen schreibt er nun in seinem aufwühlenden Text – deren klingenden Rhythmus Hinrich Schmidt-Henkel so wunderbar zu übertragen vermag – über den verzweifelten Kampf seiner Mutter gegen die entwürdigenden Mühlen der prekären Existenz und die Abwärtsspirale aus Kontrollverlust und Selbstaufgabe. Dabei legt er den Finger nicht nur in die Wunden, die andere hinterlassen haben, sondern auch in die selbst verschuldeten. »Ich erkannte Schwierigkeiten nicht, die du hattest.«
Als Louis im Internat lebt, ruft ihn eines Abends seine Mutter an. Ebenso ungläubig wie freudig erregt gesteht sie, sich von seinem Vater getrennt zu haben. Während der Vater im Elend ertrinkt, beginnt die Mutter in Paris noch einmal von vorn. Sie verlässt die Verliererseite, ihrer sozialen Klasse entkommt sie nicht. Aber sie findet so etwas wie Glück und die Freiheit einer Frau. »Für manche ist die Identität als Frau gewiss eine bedrückende Identität; für sie bedeutete das Frau-Werden eine Errungenschaft.«


[…] Werk in Deutschland inzwischen einen festen Platz hat. Gemeinsam mit Didier Eribon und Édouard Louis bildet sie die Speerspitze der soziologisch unterfütterten autobiografischen Prosa […]
[…] Identität mitdenkt und -schreibt. Andere französischsprachige Autor:innen wie Didier Eribon oder Édouard Louis haben diese Art der Literatur übernommen, die inzwischen auch in Deutschland in den Werken von […]
[…] Soziologie an der École nationale supérieure d’arts in Paris, gemeinsam mit Didier Éribon und Édouard Louis folgt er der kultursoziologischen Denkschule von Pierre Bourdieu. Zuletzt erschien seine Hommage an […]
[…] Literatur »für uns« ganz unten […]