Hanya Yanagiharas aufwühlendes Freundschaftsepos »Ein wenig Leben« ist ein Extremfall der Literatur. In seiner postmodernen, post-migrantischen, post-sexuellen und Post-Gender-Form nötigt er zur permanenten Grenzüberschreitung.
Kann man ernsthaft mit jemandem befreundet sein, wenn man ständig damit rechnet, getäuscht zu werden? Ist das Gute noch vorstellbar, wenn die Grunderfahrung im Schlechten besteht? Lohnt sich ein wenig Leben, wenn dessen Fülle vollkommen unerreichbar bleibt? Dies sind nur einige Fragen, die bei der Lektüre von Hanya Yanagiharas Ein wenig Leben aufkommen. Der knapp eintausend Seiten zählende Roman hat die 42-jährige Autorin ganz nach oben in den amerikanischen Literatenhimmel katapultiert. Er stand auf der Shortlist für den Man Booker Prize, Shortlist für den National Book Award und gewann neben Ta-Nehisi Coates Zwischen mir und der Welt 2015 den hoch dotierten Kirkus Prize. Dennoch wurde kaum ein Buch in den USA derart kontrovers diskutiert. Dies liegt zum einen daran, dass in dieser epischen Erzählung eigentlich nicht allzu viel Handlung steckt, zum anderen an der überwältigenden Intensität, die von dieser Geschichte dennoch ausgeht.
Ein wenig Leben beginnt wie ein Großstadt-Bildungsroman, in dessen Mittelpunkt vier befreundete New-England-Studenten stehen. Willem Ragnarsson ist der Sohn europäischer Einwanderer, die in Wyoming ihr Glück gesucht und eine Ranch gepachtet haben. Seine Herkunft ist sein Antrieb, er will raus aus der Enge der Provinz und als Schauspieler die Welt erobern. Er lässt von diesem Plan auch nicht ab, als er zunächst keine Aufträge erhält und sich als Aushilfskellner durchschlagen muss. Der Gegenentwurf zu Willem ist Malcom Irvine, ein angehender Architekt, der von den Erwartungen seiner wohlhabenden Eltern überfordert ist. Er wählt zunächst den Weg als Dandy, findet aber schließlich seinen Platz. Der dritte im Bunde ist der pansexuelle Künstler Jean-Babtiste Marion alias JB. Der Sohn haitianischer Einwanderer hilft nach seinem Studium bei einem kleinen Kunstmagazin aus und hofft, eines Tages darin Thema zu sein. Sein größtes Kunstprojekt besteht in der fotorealistischen Dokumentation seines Freundes Jude St. Francis. Eben jener beschließt das Quartett. Der angehende Anwalt ist mit allerlei körperlichen Schwierigkeiten geschlagen, über deren Ursprung er sich krampfhaft bedeckt hält. »Er hat nie ein Date, wir kennen seinen ethnischen Hintergrund nicht, wir wissen eigentlich gar nichts über ihn«, beschreibt JB seinen Freund an einer Stelle. Die Handlung des Romans wird sich wesentlich damit befassen, die Leerstelle von Judes Vergangenheit zu füllen.
Der Roman folgt den Schicksalen der vier Freunde über mehrere Jahrzehnte hinweg, wenngleich dies zu behaupten schon ein Wagnis ist. Denn Yanagihara lässt wie Dali die Zeit zerrinnen. Es gibt weder Andeutungen, in welchem New York der Roman spielt, noch Hinweise, über welchen Zeitraum hinweg sich die Erzählung erstreckt. Allein die Entwicklung der Freundschaft zwischen Jude, JB, Malcom und Willem sowie das Fortschreiten ihrer Karrieren lassen erahnen, dass es mehrere Jahrzehnte sein müssen. Man könnte den Roman daher als postrealistisch bezeichnen, er ist aber auch postmodern, post-migrantisch, post-gender und post-sexuell. Denn wenngleich die Autorin die verschiedenen Aspekte der dem Präfix post- folgenden Zuschreibungen in ihren Figuren verankert, tut sie dies nicht mit der Absicht, dies für die Handlung bedeutsam werden zu lassen.
Ein wenig Leben ist so unablässig und umfänglich auf den Menschen und all seine Spielarten des Daseins abgestellt, wie man es selten findet. Kategorien wie Ethnizität, Sexualität oder politische Identität spielen keine Rolle. Umso befreiter spielt die Amerikanerin mit hawaiianischen Wurzeln mit ihnen, um ihre Figuren aus den herkömmlichen Klischees herauszuführen und ihnen größtmögliche Authentizität zu verleihen. Vielleicht ist es diese Eigenschaft, die sie am stärksten mit der Fotografin Diane Arbus verbindet, die sich auch nichts aus Konventionen und Klischees machte. Ihre berühmte Aufnahme des Schlangenmenschen Joe Allen habe sie beim Schreiben immer wieder inspiriert, räumte Yanagihara in einem Gastbeitrag für das Kulturmagazin vulture.com ein. Das Foto zeigt den Mann in seinem Hotelzimmer als Backwards Man – seine Füße zeigen in die eine, sein Oberkörper in die andere Richtung. »Joe Allen ist eine Metapher für das menschliche Schicksal«, schrieb Arbus 1961 in ihr Notizbuch. »Der Mann, der sehen kann, wo er war«, der blind in die Zukunft läuft und dabei seinen Blick in die Vergangenheit wirft.
Die Vergangenheit ist in Yanagiharas Roman ein schwarzer Nebel, der Jude immer wieder von allen anderen isoliert. Wenn der undurchdringliche Dunst ihn umhüllt und Jude von seiner mysteriösen Vergangenheit überrollt wird, überfallen ihn unkontrollierbare Schmerzattacken, gegen die auch sein Freund und Arzt Andi – dessen Bedeutung im Roman zunimmt – nichts tun kann. »Sein Körper gehört nicht ihm, er gehört seinem Körper«, beschreibt er die Situation an einer Stelle. Um diesen rebellierenden Körper zumindest zu einem Teil zurückzuerobern, malträtiert ihn Jude mit Rasierklingen und Auszehrung, bis es ihm das Bewusstsein raubt und die Dämonen verschwinden. Das verzehrte Gesicht auf dem Titel des Buches stammt vom Orgasmic Man, den der amerikanisch-ukrainische Fotograf Peter Hujar 1969 ins Bild gesetzt hat, noch bevor ihm Susan Sontag und Andy Warhol Modell saßen.

Die allwissende Erzählerstimme nutzt diese Delirien, um in Rückblenden Judes Lebensgeschichte zu rekonstruieren. Dabei tritt eine Mark und Bein erschütternde Geschichte zutage, in der aus psychischer, physischer und sexueller Missbrauch ein brutales Monstrum hervorgeht, dass sich tief in Judes Seele gefressen hat und ihm beständig zuflüstert, dass er es genau so und nicht anders verdient hat. Es beginnt fast prophetisch in frühester Kindheit, als ihn seine leiblichen Eltern einer Tasche neben den Mülltonnen ablegen, denn wie Müll wird er sich den Rest seines Lebens fühlen. Den deprimierenden Episoden in verschiedenen Pflegefamilien folgen Jahre des Missbrauchs im Priesterseminar. Zuflucht und Geborgenheit findet er nur bei Bruder Luke, doch selbst das hat mehr Schatten als Licht. Der Mönch wird mit dem Zehnjährigen abhauen.
Es ist der Anfang einer bedrückenden Odyssee durch Amerikas Motels, in denen er den Jungen an fremde Männer verkauft, um ihn hinterher »zu trösten«. Als die Polizei Bruder Luke festnimmt, soll Jude zurück ins Kloster. Er türmt und läuft seinem nächsten Peiniger in die Arme, einem gewissen Dr. Taylor, der den Teenager aus unbekannten Gründen eine gefühlte Ewigkeit in seinem Keller gefangen hält und quält. Das erinnert an Park Chan-wooks in Cannes ausgezeichneten Thriller Oldboy, allerdings gelingt Jude die Flucht aus dem Haus nur zu einem verdammt hohen Preis. Die Erfahrung, der Willkür eines anderen ausgeliefert zu sein, wird er später auch in einer verhängnisvollen Beziehung sammeln, bevor er in Willem einen verständnis- und aufopferungsvollen Lebenspartner findet.
Seine traumatische Vergangenheit behält Jude jahrelang krampfhaft für sich, wenngleich die Selbstverstümmelungsexzesse seine Umgebung zunehmend ahnen lassen, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Erst sehr spät und unter Druck wird sich Jude Willem gegenüber öffnen, der mehr und mehr in Fassungslosigkeit erstarrt. Schon bald will er nicht einmal mehr nachfragen, wenn Dinge im Vagen bleiben, weil jede Frage bedeuten würde, »einen Arm in den von Schlangen und Tausendfüßlern wimmelnder Dreckhaufen zu stecken, der Judes Vergangenheit war.« So wie Willem geht es nahezu jeder Person, die Jude nahesteht. Diesen Bogen der Angst vor der Wahrheit spannt Yanagihara etwas zu lang, als dass es für den Leser nachvollziehbar ist.
Die physische Präzision, mit der die junge Autorin in der fabelhaften Übersetzung von Stephan Kleiner die Gewalt, die Jude erfährt oder sich selbst antut, beschreibt, geht über die Grenze des Erträglichen hinaus – vergleichbar vielleicht nur mit Bret Easton Ellis American Psycho. Deshalb ist auch die Perspektive relevant, ein Ich-Erzähler Jude wäre weder glaubhaft noch zu ertragen. Ihr geht es dabei nicht um literarische Provokation oder Voyeurismus, sondern um das Erklären von Judes Verhalten in der erzählten Gegenwart. Dabei konfrontiert sie die Leser mit dessen Trauma in einer derart radikalen Weise, dass ein Abwenden aus Gründen des eigenen Unwohlseins geradezu unmöglich ist. Seine Elendsgeschichte nicht sehen zu wollen, beseitigt sie nicht. Sie gehört zur Wahrheit dieses Romans. Wer sie nicht erträgt, darf diese Geschichte nicht lesen.
Um potentielle Rezensenten nicht zu früh abspringen zu lassen, hat der Verlag im vergangenen Herbst einzelne Journalisten, dazu gehört auch der Autor dieses Textes, sowie Blogger und Buchhändler zu einem Lese-Retreat eingeladen. Ein Bungalow mit vollem Kühlschrank sowie das Buch wurden jeweils für drei Tage zur Verfügung gestellt, um sich mit dem Roman auseinanderzusetzen. Vor dem Hintergrund, dass Zeit auch für Profileser ein immer wertvolleres Gut ist, sind drei Tage in der Abgeschiedenheit keine allzu schlechte Strategie. Hat es sie gebraucht, um den Roman wirken zu lassen? Nein, das sicher nicht. Erwartungen wurden übrigens nicht formuliert, nicht einmal die, den Roman in den drei Tagen zu lesen.
Der Text kommt einer permanenten Grenzüberschreitung gleich, immer wieder will man das Buch angewidert von sich werfen. Und doch kann man es nicht. Denn der Roman überwältigt nicht in der Schilderung der Gewalt, sondern in den Momenten der Nähe, Geborgenheit und Empathie. Von ihnen geht eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus, die den Leser bei Jude und seiner Geschichte hält. So sehr Jude – vor allem als Kind – Gewalt und Peinigung erfahren hat, so sehr wird ihm später aufopferungsvolle Güte und bedingungslose Liebe zuteil. Diese Szenen gehören zu den ergreifendsten und zärtlichsten, die die Gegenwartsliteratur hervorgebracht hat. Man muss ein Eisklotz sein, um hier nicht Tränen der Rührung zu vergießen.
Judes Charakter ist so angelegt, dass eine Besserung nicht möglich und Hoffnung vergebens ist. »Du bist dafür gemacht«, heißt es, als ihm einmal mehr Gewalt angetan wird. Konsequenterweise findet sich der Titel des Romans auf den fast 1.000 Seiten auch nur an einer der düstersten Stellen wieder. Als er mit Bruder Luke von Motel zu Motel reist, immer auf der Flucht vor der Polizei, säuselt der Kirchenmann dem kindlichen Jude ins Ohr: »Ich weiß, dass du müde bist. Das ist normal; du wächst. Wachsen ist Arbeit. Aber Jude, wenn du Kunden hast, musst du ein wenig Leben an den Tag legen; sie bezahlen, um Zeit mit dir zu verbringen.«
»Dinge gehen kaputt, und manchmal können sie wieder repariert werden«, heißt es im Roman, als Jude versehentlich ein Erinnerungsstück kaputt macht. In Ein wenig Leben ist Jude derjenige, der in Scherben liegt. Die zentrale Frage lautet, ob sein versehrter Körper und noch mehr seine so brutal gebrochene Seele durch Liebe und Empathie Heilung finden können.
Der Mensch heißt Mensch, sing Herbert Grönemeyer, weil er wärmt, wenn er erzählt. Ein wenig Leben wärmt in der Dunkelheit, weil sich diese Erzählung auf den Menschen in all seiner Emotionalität konzentriert. Dieser Roman ist ganz ohne Zweifel ein Meisterwerk, aufwühlend, hochkontrovers, empathisch und immer wieder kaum zu ertragen, vergleichbar mit Nabokovs Lolita oder A. M. Holmes Das Ende von Alice. Wie diese nimmt auch Yanagiharas Werk nimmt kein gutes Ende, aber eines, das glaubwürdiger nicht sein könnte.
Diesen Roman zu lesen ist wie im Auge eines Orkans zu sitzen. Man ist zwar einigermaßen sicher, aber fühlt die existenzielle Gefahr des Sturms am eigenen Leib. Die gleichermaßen klare wie bilderreiche Prosa, flüssig übersetzt von Stephan Kleiner, ist eine permanente Zumutung, immer wieder will man das Buch angewidert von sich werfen. Zurückgehalten wird man von überwältigenden Momenten voller Zuneigung, Geborgenheit und Empathie. Diese Szenen aufopferungsvoller Selbstlosigkeit und bedingungsloser Liebe gehören zu den ergreifendsten und zärtlichsten, die die Gegenwartsliteratur hervorgebracht hat. Ein wenig Leben geht in jedem Sinne unter die Haut und lässt vor Ehrfurcht erzittern.
Schon in Yanagiharas erstem Roman The people in the trees ging es um Missbrauch. Hier nun verschiebt sie den Fokus auf die heilende Kraft von Liebe und Freundschaft. »Der Trick bei Freundschaften besteht darin, Menschen zu finden, die besser sind, als man selbst – nicht klüger, nicht cooler, sondern liebenswürdiger und großzügiger und nachsichtiger«, heißt es an einer Stelle. »Und ihnen zu vertrauen, was der schwierigste Teil ist. Aber auch der beste.« Wie schwer es ist, zu diesem besten Teil durchzudringen, wenn das Gute unvorstellbar ist, davon erzählt dieser große Roman.
Im Freitag erschien bereits dieser etwas kürzere Beitrag zum Buch. Das Titelbild des Beitrags ist ein Auszug eines Screenshots von Peter Hujars »Orgasmic Man«. Das Original wurde auch für den Titel des Buches verwendet.



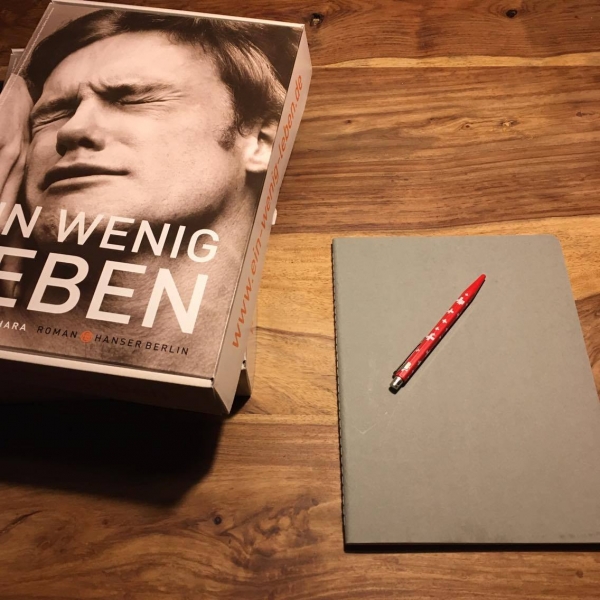




[…] Volk der Bäume« ist das nachgereichte Debüt von Hanya Yanagihara, die mit »Ein wenig Leben« eines der besten und meistdiskutierten Bücher der letzten Jahre geschrieben hat. Im Mittelpunkt dieses zeitlosen […]
[…] nimmt sie durchaus kontroverse Positionen ein, etwa wenn sie über Hanya Yanagiharas »Ein wenig Leben« (»…eine achthundertseitige sinnlose Wehklage über Vergewaltigung, Selbstverletzung, […]